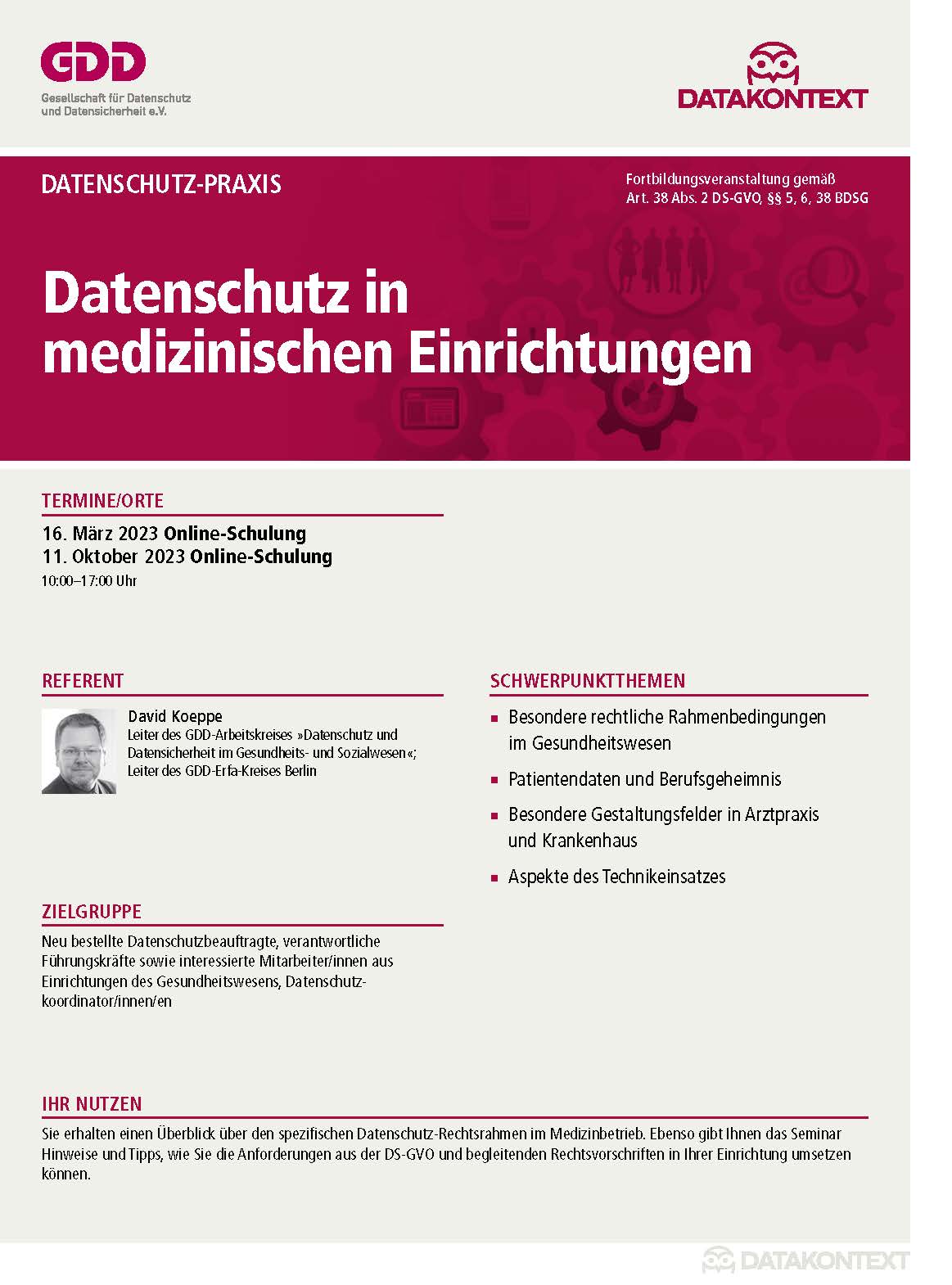Einsicht in die Patientenakte (630g BGB) vs. Auskunftsrecht nach Art. 15 DS-GVO

Wenn sich Patienten über den Inhalt der Behandlungsdokumentation, also ihrer Patientenakte, informieren möchten, kommen mehrere Rechtsnormen in Betracht, auf die sie dieses Begehren stützen können.
So enthält zum einen das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) mit § 630g eine Regelung, die einen Anspruch auf Einsicht in die Patientenakte und auf Erhalt elektronischer Abschriften der Akte im Rahmen des Behandlungsvertrags zwischen Behandelndem und Patient begründet.
Auch die Berufsordnungen der Ärztinnen und Ärzte verpflichten den Arzt berufsrechtlich dazu, dem Patienten Einsicht in die Behandlungsdokumentation zu gewähren und auf Verlangen Kopien herauszugeben. So findet sich bspw. in § 10 Dokumentationspflicht der (Muster-)Berufsordnung folgende Regelung:
„[…] Ärztinnen und Ärzte haben Patientinnen und Patienten auf deren Verlangen grundsätzlich in die sie betreffenden Krankenunterlagen Einsicht zu gewähren; ausgenommen sind diejenigen Teile, welche subjektive Eindrücke oder Wahrnehmungen der Ärztin oder des Arztes enthalten. Auf Verlangen sind der Patientin oder dem Patienten Kopien der Unterlagen gegen Erstattung der Kosten herauszugeben […].“
In ihrem 29. Tätigkeitsbericht (Abschnitt 3.22) weist die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit im Saarland darauf hin, dass insbesondere das Verhältnis des datenschutzrechtlichen Auskunftsanspruchs gemäß Art. 15 DS-GVO zu dem in § 630g BGB normierten Recht auf Einsichtnahme in die Patientenakte nicht abschließend geklärt zu sein scheint, obwohl die Abgrenzung in der Praxis eine erhebliche Relevanz besitze.
Ein Unterschied dürfe bereits darin bestehen, dass Art. 15 Abs. 3 DS-GVO einen Anspruch auf eine kostenlose Kopie der personenbezogenen Daten begründe, während nach § 630g BGB die Kosten für die Kopie der Behandlungsdokumentation dem Patienten in Rechnung gestellt werden dürften.
Das Unabhängige Datenschutzzentrum Saarland stelle bisher bei der Bearbeitung von Anfragen oder Beschwerden in diesem Zusammenhang darauf ab, welches Anliegen der betroffene Patient im konkreten Fall verfolge.
Gehe es dem Patienten vorrangig um die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten (z.B. Empfänger, Speicherdauer), könne von einem Auskunftsersuchen nach Art. 15 DS-GVO ausgegangen werden. Stehe dagegen der Inhalt des Behandlungsverlaufs im Vordergrund, wie beispielsweise in Fällen, in denen der Patient seine Akte bei einem Wechsel der Praxis zum neuen Arzt mitnehmen möchte und deshalb eine vollständige Kopie benötige, erscheine § 630g BGB als einschlägige Rechtsgrundlage, zumal der Umfang der Datenkopie, die nach Art. 15 Abs. 3 DSGVO verlangt werden kann, nach wie vor umstritten sei.
–
Die LfDI Saarland hatte bereits in ihrem 28. Tätigkeitsbericht das Thema der Einsichtnahme in die Patientenakte aufgegriffen.
In welchem Verhältnis § 630g BGB und Art. 15 DSGVO zueinander stehen, wird von den datenschutzrechtlichen Aufsichtsbehörden unterschiedlich beurteilt.
Auch der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (HBfDI) hat sich vor geraumer Zeit mit dem Verhältnis dieses beiden Normen beschäftigt. Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit scheint den Anwendungsbereich bzw. die der betroffenen Person aus den Normen gewährten Rechte jedoch anders zu beurteilen:
“ Einen Anspruch auf Herausgabe einzelner Kopien, z. B. im Sinne einer Fotokopie bestimmter Dokumente, enthält Art. 15 Abs. 3 DS-GVO in aller Regel jedoch nicht. Vielmehr ist der Kopie-Begriff des Art. 15 Abs. 3 DS-GVO im Sinne einer sinnvoll strukturierten Zusammenfassung zu verstehen.„, so der HBfDI.
„Es ist daher davon auszugehen, dass der Bundesgesetzgeber in der Akteneinsicht nach § 630g BGB eine von dem Auskunftsanspruch und dem Recht auf Kopie des Art. 15 DS-GVO unabhängige Regelung mit anderem Inhalt und anderem Zweck sieht. § 630g BGB ist damit keine Einschränkung des Rechts auf Auskunft nach Art. 15 DS-GVO. Die Norm dient anderen Patienteninteressen als Art. 15 DS-GVO. So erleichtert eine gut geführte Patientenakte den Arztwechsel, weil sie dem übernehmenden Mediziner die Anknüpfung an das zuvor Geleistete erleichtert und dadurch die nochmalige Durchführung diagnostischer oder therapeutischer Maßnahmen vermeiden hilft„, so der HBfDI weiter.
Durch ein Urteil des Landgerichts Dresden (Urteil vom 29.5.2020 6 O 76/20) sieht die LfDI hingegen ihre bislang vertretene Auffassung gestützt.
Das Landgericht Dresden urteilte, dass einer Patientin gegenüber einem Krankenhaus neben der spezialgesetzlichen Regelung des § 630 g BGB auch ein Auskunftsanspruch aus Art. 15 Abs. 3 DS-GVO zustehe.
Art. 15 Abs. 3 DS-GVO berechtige den Patienten, unentgeltlich vom Behandler Auskunft über die verarbeiteten personenbezogenen Daten des Patienten in Form der Herausgabe der Patientendokumentation in Kopie bzw. einem maschinenlesbaren Format (hier PDF-Datei) zu verlangen.
(Foto: momius – stock.adobe.com)
Letztes Update:21.04.21
Verwandte Produkte
Das könnte Sie auch interessieren
-

Folge 81: Wer haftet für KI-Schäden?
Im November 2025 hat die GEMA in einem wichtigen Verfahren vor dem Landgericht München einen Sieg gegen Open AI, den Entwickler von ChatGPT, errungen. Die spannende Frage lautet spitz gestellt: Befinden sich in KI-Modellen Vervielfältigungen von urheberrechtlich geschützten Inhalten? Das Gericht in München hat das bejaht. Die Materie ist kompliziert, aber wichtig. Was bedeutet die
Mehr erfahren -

Folge 80: KI als Lernprozess – Raphaela Edelbauer erhält den GDD-Datenschutzpreis 2025
Die österreichische Autorin Raphaela Edelbauer hat 2021 ihr Buch DAVE vorgelegt. Der mit dem Österreichischen Buchpreisausgezeichnete Science-Fiction-Roman sieht die Menschheit auf dem Weg in ein kollektives künstliches Bewusstsein. In dieser Welt ist die Privatsphäre bedeutungslos geworden und der Datenschutz hat sein Schutzobjekt verloren. Der GDD-Vorstand hat Raphaela Edelbauer für diese kluge Mahnung zur Wahrung der
Mehr erfahren -

Folge 79: Datenschutzmanagementsoftware im Praxischeck
Die rechtlichen Anforderungen an die Umsetzung der technisch-organisatorischen Maßnahmen an die Datenverarbeitung nach der DS-GVO werden immer komplexer. Vor diesem Hintergrund stellt sich Frage nach tauglicher Software immer drängender. Der Rechtsanwalt Michael Rohrlich und Datenschutzberater Marc Oliver Thoma testen regelmäßig derartige Tools. Im Podcast geben die Experten GDD-Geschäftsführer Andreas Jaspers und mir unter anderem Auskunft
Mehr erfahren