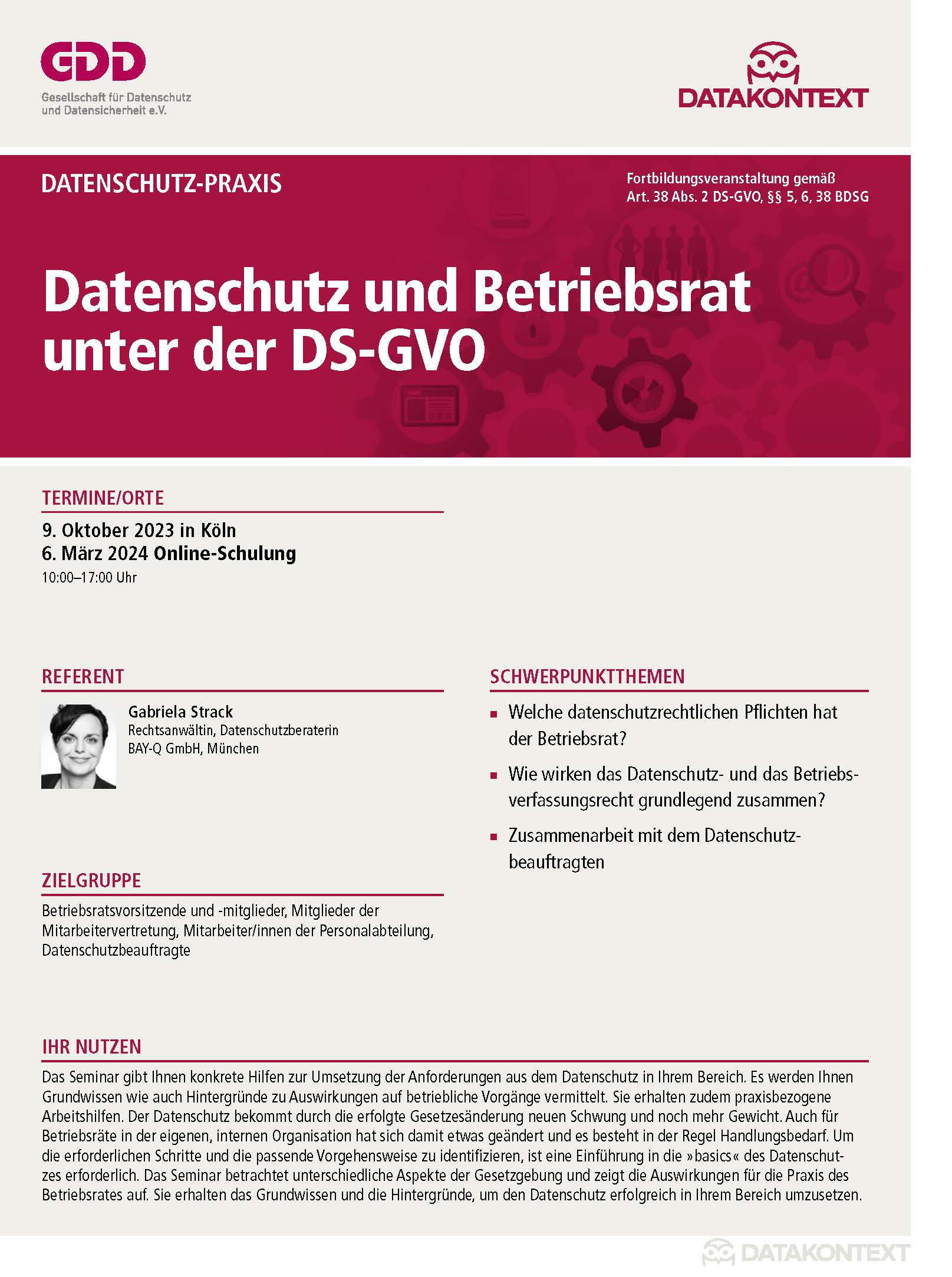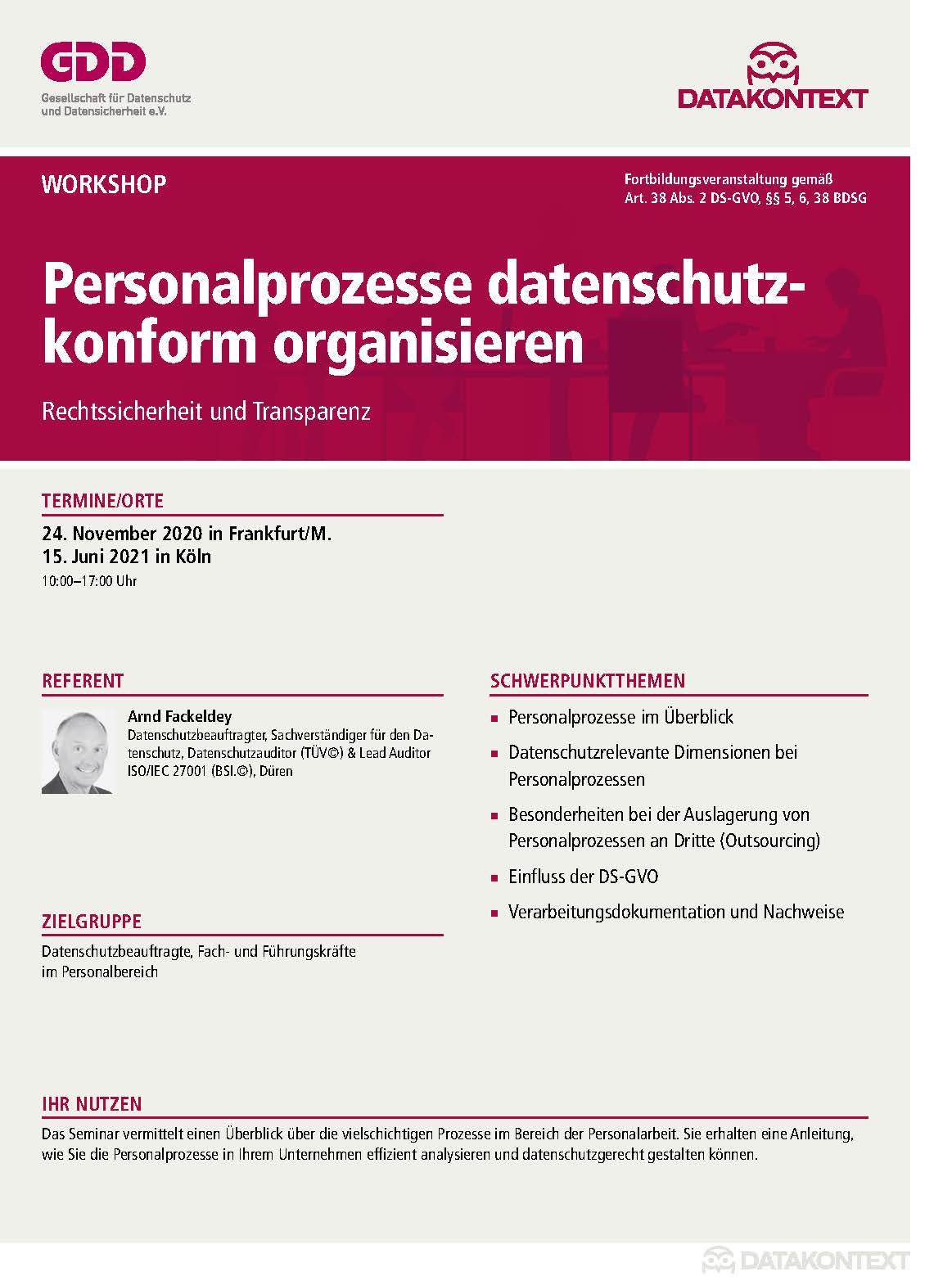Betriebliches Eingliederungsmanagement: Weitergabe von Gesundheitsdaten an Betriebsrat

Die Öffnungsklauseln der DS-GVO lassen nationale Regelungen zur Datenverarbeitung im Beschäftigungskontext öffentlicher Stellen zu (siehe Artikel 6 Absatz 2 und Absatz 3 Buchstabe b DS-GVO sowie Artikel 88 DS-GVO). Der Bundesgesetzgeber hat unter anderem mit den spezialgesetzlichen Regelungen in den Sozialgesetzbüchern hiervon Gebrauch gemacht.
Bei der Durchführung des Verfahrens für das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) nach § 167 Absatz 2 SGB IX handelt es sich um eine originäre Aufgabe der Personalverwaltung. Beim BEM werden eine Vielzahl von personenbezogenen Daten der Beschäftigten (zum Beispiel Namen und Kontaktdaten, siehe Art. 4 Nummer 1 DS-GVO) verarbeitet. Zudem werden beim BEM besondere Kategorien personenbezogener Daten der Beschäftigten verarbeitet, zum Beispiel Gesundheitsdaten im Sinne von Art. 4 Nummer 15 DS-GVO (siehe Artikel 9 DS-GVO). Die im Zusammenhang mit dem BEM erhobenen personenbezogenen Daten der Beschäftigten (Betroffene) unterliegen einer strengen Zweckbindung (vgl. LfD Niedersachsen „Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM); Datenschutzrechtliche Aspekte zur Verfahrensweise„).
Bei dem BEM nach § 167 Abs. 2 des Neunten Buchs des Sozialgesetzbuchs handelt es sich um eine originäre Aufgabe der Personalverwaltung, die hinsichtlich der Verwendung der erhobenen Daten einer strengen Zweckbindung unterliegt. Das BEM wirft wichtige Fragen zur zulässigen Verwendung von (Gesundheits-) Daten der Beschäftigten auf. Dies zeigt ein aktueller Fall, der unter anderem zur Verhängung eines Bußgeldes durch die LDI NRW führte (27. Tätigkeitsbericht, Ziffer 9.1).
Die LDI NRW weist in ihrem Tätigkeitsbericht darauf hin, dass im Rahmen eines BEM-Verfahrens Gesundheitsdaten aus der BEM-Akte nicht in die Personalakten der betroffenen Beschäftigten übernommen werden dürfen. Sie müssen in einer separaten BEM-Akte räumlich und funktional getrennt von der Personalakte aufbewahrt werden. In die Personalakte dürfen nur solche Angaben aufgenommen werden, die zum Nachweis des ordnungsgemäßen BEM-Verfahrens erforderlich sind. Hierzu gehören Angaben, ob und wann die Durchführung eines BEM angeboten wurde, ob die betroffene Person hiermit einverstanden war oder das BEM abgelehnt hat und welche konkreten Maßnahmen angeboten und umgesetzt wurden.
Im BEM-Verfahren erhobene Gesundheitsdaten dürfen zudem nicht für andere Zwecke, beispielsweise zur Vorbereitung einer krankheitsbedingten Kündigung, genutzt und an den Betriebsrat weitergeben werden. Im Falle einer Kündigung darf zur Unterrichtung des Betriebsrats nach §§ 80 Abs. 1, 102 BetrVG nur der Nachweis erbracht werden, dass ein BEM-Verfahren den betroffenen Beschäftigten als milderes Mittel angeboten und ggf. auch durchgeführt wurde.
(Foto: pictworks – stock.adobe.com)
Letztes Update:03.07.22
Verwandte Produkte
Das könnte Sie auch interessieren
-
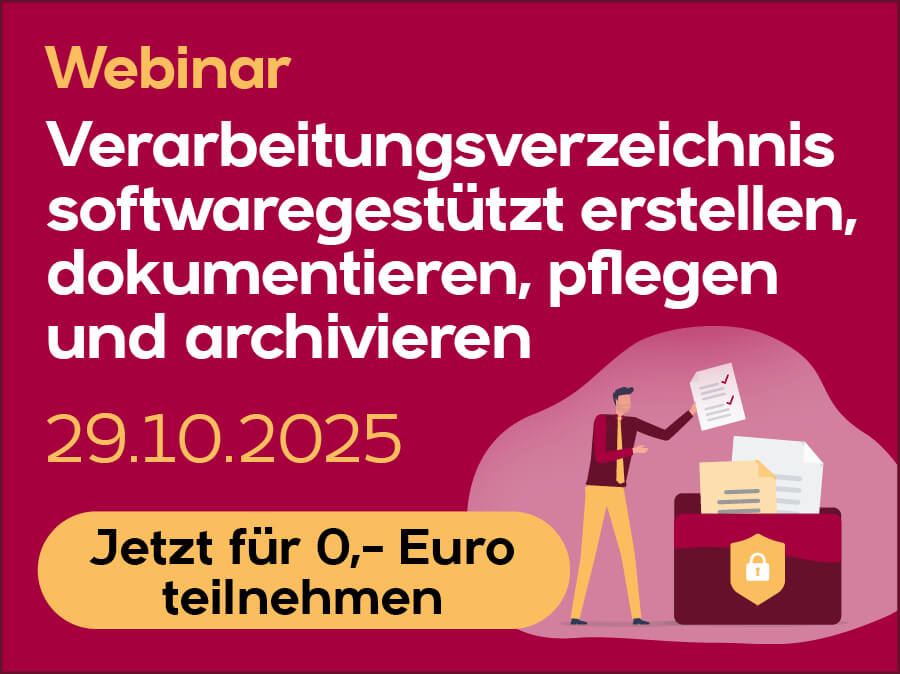
Webinar Verarbeitungsverzeichnis softwaregestützt erstellen, dokumentieren, pflegen und archivieren
Mit dem webbasierten Management-System DataAgenda Datenschutz Manager können Sie alle Maßnahmen zum Datenschutz erfassen, verwalten und dokumentieren (VVT, DSFA etc.) und so Ihre Rechenschaftspflicht gemäß DS-GVO erfüllen. Der Referent zeigt, wie Sie mit einem Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten (VVT) gemäß Art. 30 DS-GVO einen zentralen Baustein der Datenschutzdokumentation erstellen. Sie erfahren, wie der DataAgenda Datenschutz Manager
Mehr erfahren -

BSI veröffentlicht Handreichung zur NIS-2-Geschäftsleitungsschulung
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat eine neue Handreichung zur Geschäftsleitungsschulung im Rahmen der NIS-2-Umsetzung veröffentlicht. Die Publikation richtet sich an Führungsebenen von Unternehmen und Einrichtungen, die künftig unter die NIS-2-Regulierung fallen – also als „wichtige“ oder „besonders wichtige Einrichtungen“ gelten. Ziel ist es, Geschäftsleitungen auf ihre neuen Pflichten im Bereich Cybersicherheit
Mehr erfahren -

Refurbished Notebook mit ungelöschten Daten – wer ist verantwortlich?
Der Erwerb gebrauchter oder „refurbished“ IT-Geräte wirft nicht nur technische, sondern auch datenschutzrechtliche Fragen auf. Besonders heikel wird es, wenn auf einem erworbenen Notebook noch personenbezogene Daten des Vorbesitzers vorzufinden sind. Doch wer trägt in diesem Fall die Verantwortung nach der DS-GVO? Verantwortlichenbegriff nach Art. 4 Nr. 7 DS-GVO Nach Art. 4 Nr. 7 DS-GVO
Mehr erfahren