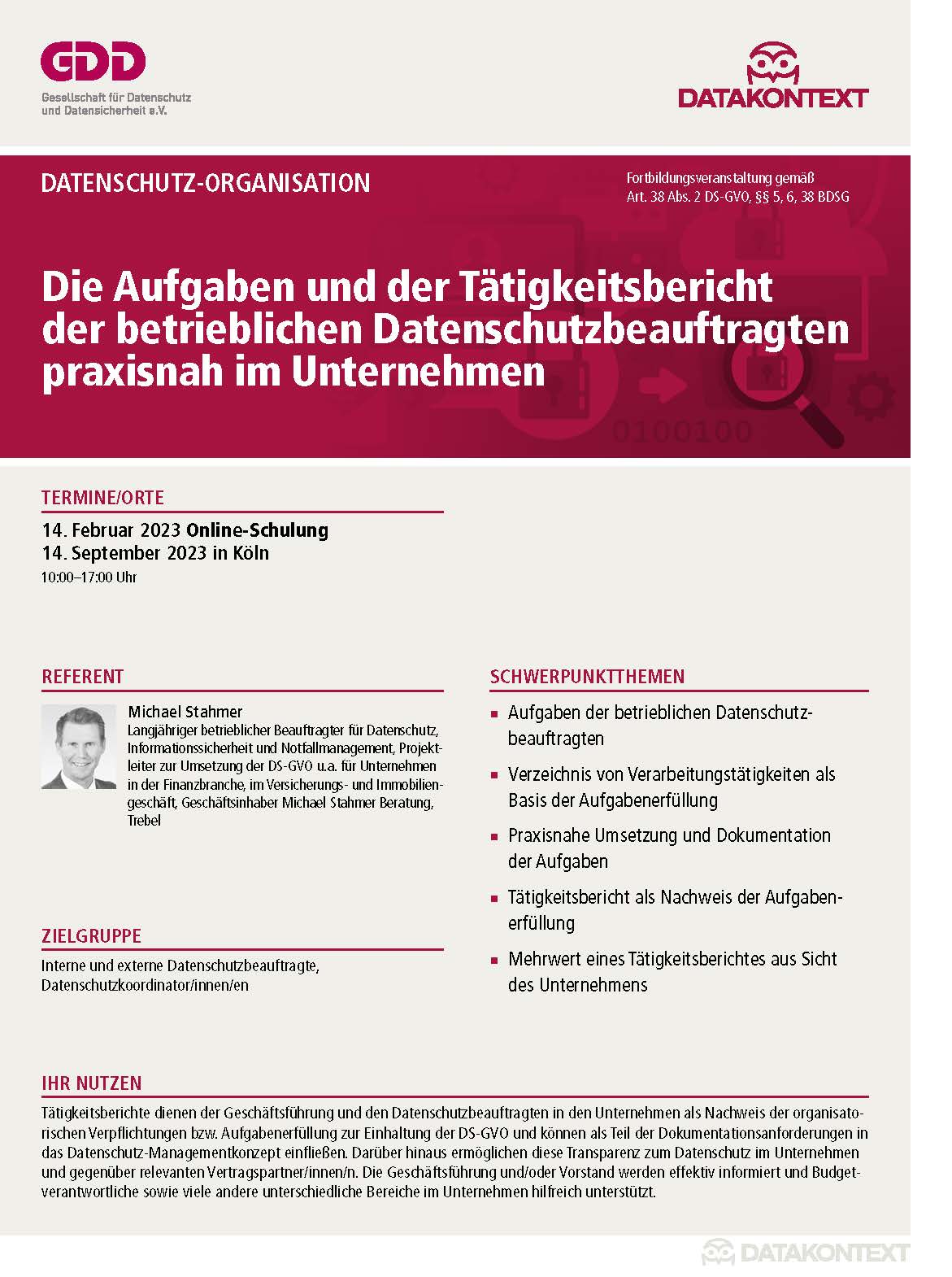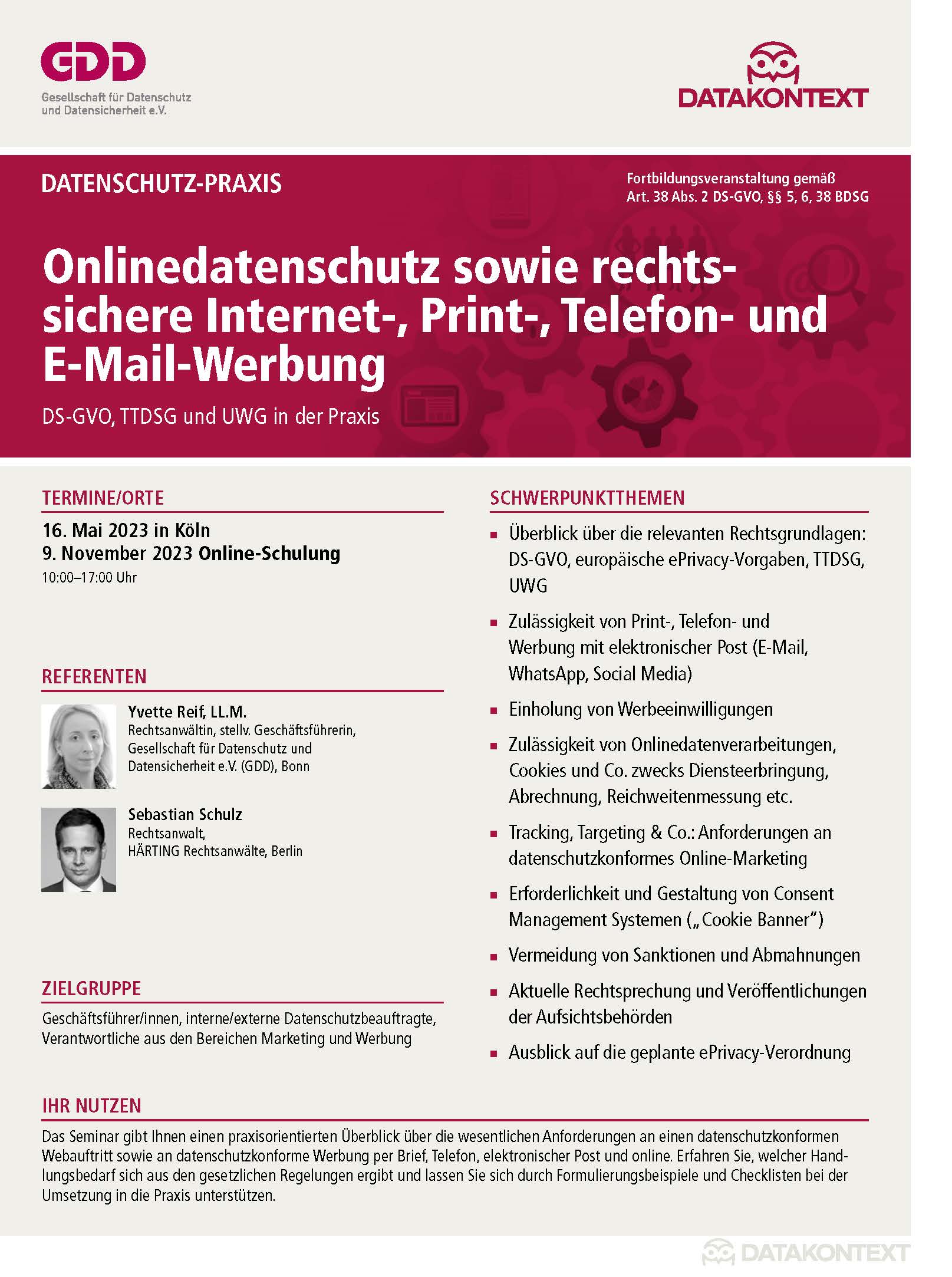Einwilligung als „zusätzliche Rechtsgrundlage“

Art. 4 Nr. 11 DS-GVO definiert die Einwilligung als „jede freiwillig für den bestimmten Fall, in informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist.“
Die Einwilligung ist daher einerseits Betroffenenrecht, da sie der betroffenen Person die Möglichkeit gibt, aktiv über die Verarbeitung, ihre Zwecke und näheren Umstände zu bestimmen. Andererseits ist sie aus Sicht des Verantwortlichen ein vollgültiger Erlaubnistatbestand im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO. Mittels einer Einwilligung können ggf. Verarbeitungen gerechtfertigt werden, die allein auf Grundlage der gesetzlichen Tatbestände ausgeschlossen wären (vgl. GDD-Praxishilfe DS-GVO XIII Einwilligung).
Eine der vielen Rechtsfragen, die die Einwilligung in der Praxis nach wie vor bereit hält, ist die Frage danach, wie es sich auswirkt, wenn ein Verantwortlicher der betroffenen Person die Notwendigkeit einer Einwilligung zumindest suggeriert, obwohl die Datenverarbeitung bereits durch einen anderen Erlaubnistatbestand legitimiert werden kann.
Zu dieser Frage vertritt die Sächsische Datenschutz-und Transparenzbeauftragte in ihrem Tätigkeitsbericht 2022 (Ziffer 2.3) eine klare Meinung: „Eine Datenerhebung kann sich entweder auf eine gesetzliche Grundlage oder auf eine Einwilligungserklärung stützen.„
Eine Einwilligung scheidet nach Auffassung der Sächsischen Datenschutzbeauftragten als Rechtsgrundlage regelmäßig aus, wenn eine gesetzliche Verarbeitungsbefugnis im Raum steht (so auch: Kühling/Buchner Kommentar zur DSGVO und BDSG. Art. 6 Rdnr. 24).
Eine Kombination dieser beiden Rechtsgrundlagen betrachtet die Datenschutzbeauftrate in ihrem aktuellen Tätigkeitsbericht als einen Verstoß gegen Treu und Glauben im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Buchst. a DS-GVO, wenn der betroffenen Person einerseits signalisiert wird, dass es für die Datenverarbeitung auf deren Einwilligung ankäme, andererseits aber doch jederzeit auf die Alternative der gesetzlichen Verarbeitungsbefugnis zurückgegriffen werden kann. Entweder werde eine Datenerhebung oder Datenübermittlung auf eine gesetzliche Grundlage gestützt, oder sie erfolge auf der Grundlage einer Einwilligungserklärung. Eine „Kombination“ beider Rechtsgrundlagen halte sie nicht für zulässig.
(Foto: blende11.photo – stock.adobe.com)
Letztes Update:28.05.23
Verwandte Produkte
-
Die Aufgaben und der Tätigkeitsbericht des betrieblichen DSB praxisnah im Unternehmen
Seminar
648,55 € Mehr erfahren -
Onlinedatenschutz sowie rechtssichere Internet-, Print-, Telefon- und E-Mail-Werbung
Seminar
940,10 € Mehr erfahren
Das könnte Sie auch interessieren
-

LinkedIn-Verrnetzung begründet keine Einwilligung für Werbe‑E‑Mails
Das AG Düsseldorf hat mit Urteil vom 20.11.2025 (Az. 23 C 120/25) klargestellt, dass berufliche Vernetzung in sozialen Netzwerken keine Einwilligung für den Versand werblicher E-Mails begründet. Hintergrund war ein Fall, in dem ein IT-Dienstleister zwei Werbe-E-Mails an eine GmbH sandte, die lediglich über LinkedIn vernetzt war, ohne dass eine ausdrückliche Zustimmung vorlag. LinkedIn-Kontakte ≠ Einwilligung für
Mehr erfahren -

Vergütung für nicht deklariertes „KI-Gutachten“ kann verweigert werden
Das Landgericht Darmstadt hat in einem Beschluss vom November 2025 (19 O 527/16) klargestellt, dass eine erhebliche, nicht gegenüber dem Gericht offengelegte Verwendung von Künstlicher Intelligenz (KI) bei der Erstellung eines gerichtlichen Sachverständigengutachtens zur vollständigen Versagung der Vergütung führen kann. Damit stärkt das Gericht die Anforderungen an Transparenz, persönliche Leistungspflicht und Nachvollziehbarkeit bei Gutachten, die im Rahmen zivilprozessualer
Mehr erfahren -
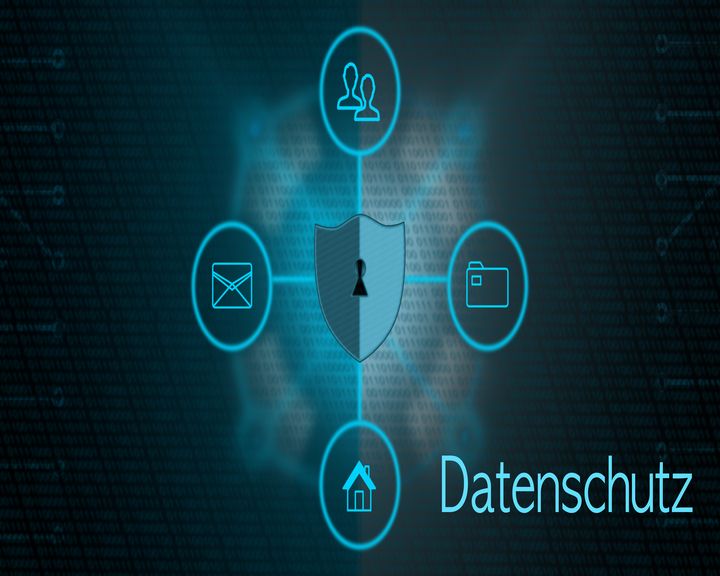
Gemeinsame Dateiablagen als datenschutzrechtliches Risiko
In der Aktuellen Kurz-Information 65 weist der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz auf die erhebliche Gefahr von Datenpannen durch gemeinsam genutzte Dateiablagen hin. Betroffen sind sowohl klassische Netzlaufwerke als auch moderne Kollaborationsplattformen wie Microsoft SharePoint. Diese Systeme dienen zwar der effizienten Zusammenarbeit, können jedoch bei unzureichender Konfiguration und Organisation zu unbeabsichtigten Offenlegungen personenbezogener Daten führen.
Mehr erfahren