BGH-Urteil: Name des Datenschutzbeauftragten muss nicht offengelegt werden

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat entschieden, dass der Name des Datenschutzbeauftragten (DSB) nicht gegenüber Dritten veröffentlicht werden muss. Dies gilt sowohl für Datenschutzerklärungen als auch für die Beantwortung von Auskunftsersuchen gemäß der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO).
Ein Kläger, der in einer Geschäftsbeziehung mit einer Bank stand, forderte umfassende Informationen gemäß seinem datenschutzrechtlichen Auskunftsrecht nach Art. 15 DS-GVO. Er bemängelte, dass die Bank den Namen des DSB nicht mitgeteilt habe und klagte auf vollständige Auskunft, einschließlich der Offenlegung des Namens des DSB.
Der BGH wies die Klage ab und stellte klar, dass die Angabe des Namens des DSB nicht zwingend erforderlich ist. Laut Art. 13 Abs. 1 lit. b DS-GVO müssen nur die Kontaktdaten des DSB mitgeteilt werden. Es genüge, wenn die betroffene Person die Kontaktdaten erhalte, die die Erreichbarkeit des DSB sicherstellen. Die Funktionsbezeichnung „Datenschutzbeauftragte“ in Verbindung mit der Adresse reiche aus, um den DSB zu kontaktieren. Der Name könne die Erreichbarkeit sogar erschweren, etwa bei personellen Veränderungen.
Bereits nach dem Wortlaut der Vorschrift bestehe keine Pflicht zur namentlichen Nennung des Datenschutzbeauftragten, sondern nur zur Mitteilung der Kontaktdaten. Dafür spreche weiter die Systematik des Gesetzes, das in unterschiedlichen Zusammenhängen die Mitteilung eines Namens ausdrücklich verlange und insoweit ersichtlich bewusst differenziere.
Auch nach Sinn und Zweck der Vorschrift bedürfe es einer Nennung des Namens nicht zwingend. Denn es komme nicht auf die Person, sondern auf deren Funktion an. Entscheidend und zugleich ausreichend für den Betroffenen sei die Mitteilung der Informationen, die für die Erreichbarkeit der zuständigen Stelle erforderlich sind. Sei die Erreichbarkeit ohne Nennung des Namens gewährleistet, müsse dieser nicht mitgeteilt werden.
BGH, Urteil vom 14.05.2024, VI ZR 370/22
(Foto DSan Race – stock.adobe.com)
Letztes Update:06.08.24
Das könnte Sie auch interessieren
-
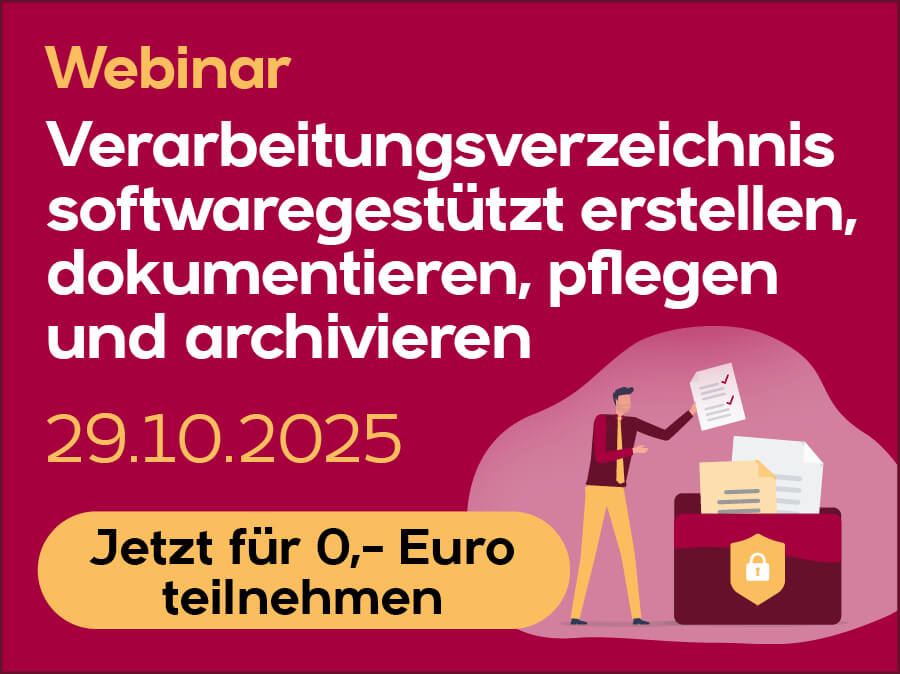
Webinar Verarbeitungsverzeichnis softwaregestützt erstellen, dokumentieren, pflegen und archivieren
Mit dem webbasierten Management-System DataAgenda Datenschutz Manager können Sie alle Maßnahmen zum Datenschutz erfassen, verwalten und dokumentieren (VVT, DSFA etc.) und so Ihre Rechenschaftspflicht gemäß DS-GVO erfüllen. Der Referent zeigt, wie Sie mit einem Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten (VVT) gemäß Art. 30 DS-GVO einen zentralen Baustein der Datenschutzdokumentation erstellen. Sie erfahren, wie der DataAgenda Datenschutz Manager
Mehr erfahren -

BSI veröffentlicht Handreichung zur NIS-2-Geschäftsleitungsschulung
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat eine neue Handreichung zur Geschäftsleitungsschulung im Rahmen der NIS-2-Umsetzung veröffentlicht. Die Publikation richtet sich an Führungsebenen von Unternehmen und Einrichtungen, die künftig unter die NIS-2-Regulierung fallen – also als „wichtige“ oder „besonders wichtige Einrichtungen“ gelten. Ziel ist es, Geschäftsleitungen auf ihre neuen Pflichten im Bereich Cybersicherheit
Mehr erfahren -

Refurbished Notebook mit ungelöschten Daten – wer ist verantwortlich?
Der Erwerb gebrauchter oder „refurbished“ IT-Geräte wirft nicht nur technische, sondern auch datenschutzrechtliche Fragen auf. Besonders heikel wird es, wenn auf einem erworbenen Notebook noch personenbezogene Daten des Vorbesitzers vorzufinden sind. Doch wer trägt in diesem Fall die Verantwortung nach der DS-GVO? Verantwortlichenbegriff nach Art. 4 Nr. 7 DS-GVO Nach Art. 4 Nr. 7 DS-GVO
Mehr erfahren



