Schadenersatz wegen verspäteter Auskunft

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat sich mit einem immateriellen Schadensersatzanspruch des Klägers nach Art. 82 Abs. 1 DS-GVO aufgrund einer vermeintlichen Verletzung seines Auskunftsanspruchs gemäß Art. 15 Abs. 1 DS-GVO befasst. Die zentralen Punkte des Urteils lassen sich wie folgt zusammenfassen:
Sachverhalt
- Der Kläger war als Koch bei der Beklagten beschäftigt und forderte Auskunft zu zwei Vorgängen (einer Versetzung und einer Abmahnung) nach Art. 15 Abs. 1 DS-GVO.
- Die Beklagte gab teilweise Auskunft, wies jedoch die Unzulässigkeit der Versetzung und die Rechtmäßigkeit der Abmahnung zurück.
- Der Kläger sah seine Auskunftsansprüche nicht vollständig erfüllt und forderte Entschädigung in Höhe von 8.000 Euro.
Entscheidungsgründe
- Rechtslage: Der Kläger hatte keinen Anspruch auf Schadensersatz nach Art. 82 Abs. 1 DSGVO, da er keinen immateriellen Schaden dargelegt hatte. Es wurde auf die Voraussetzungen eines solchen Anspruchs hingewiesen:
- Vorliegen eines Schadens,
- Vorliegen eines Verstoßes gegen die DS-GVO,
- Kausalzusammenhang zwischen Schaden und Verstoß.
- Darlegungs- und Beweislast: Es wurde betont, dass der Kläger sowohl den Verstoß gegen die DSGVO als auch den daraus resultierenden Schaden nachweisen muss. Ein bloß hypothetisches Risiko der missbräuchlichen Verwendung seiner Daten reichte nicht aus.
- Befürchtungen und negative Gefühle: Negative Gefühle, die der Kläger angibt (z.B. Sorge um die missbräuchliche Verwendung seiner Daten), können nur dann als Schadensersatzanspruch gelten, wenn diese objektiv als begründet angesehen werden können. Der Kläger konnte jedoch nicht ausreichend darlegen, dass ein erhöhtes Risiko für den Missbrauch seiner Daten besteht.
- Fehlende Differenzierung: Der Verlust der Kontrolle über personenbezogene Daten durch eine Verletzung des Auskunftsanspruchs führt nicht automatisch zu einem Schadensersatzanspruch, da dieser Verlust bei jeder Verletzung des Art. 15 DS-GVO gegeben ist.
- Hilfsweise Ansprüche: Auch die hilfsweise geltend gemachten Ansprüche aus vertraglicher oder deliktischer Haftung waren unbegründet, da ein hinreichend dargelegter Schaden fehlte.
Fazit
Das Urteil stellt klar, dass Betroffene im Falle eines Auskunftsanspruchs nach Art. 15 Abs. 1 DSG-VO nicht nur eine Verletzung der DS-GVO nachweisen müssen, sondern auch den daraus resultierenden immateriellen Schaden substantiiert darlegen müssen. Bloße negative Gefühle oder hypothetische Risiken sind hierfür nicht ausreichend.
(Foto: thodonal – stock.adobe.com)
Letztes Update:24.10.24
Das könnte Sie auch interessieren
-
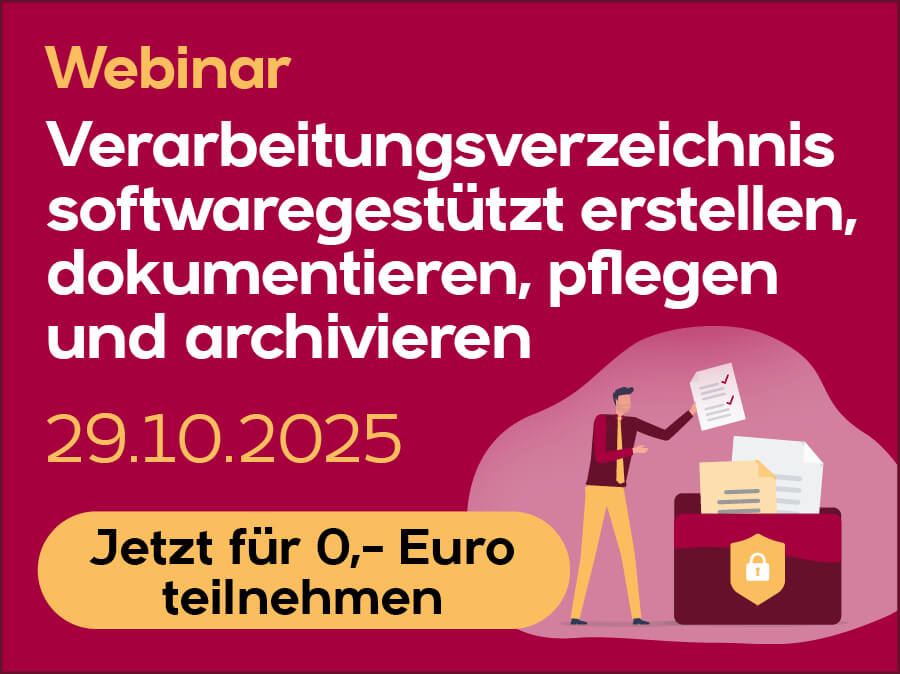
Webinar Verarbeitungsverzeichnis softwaregestützt erstellen, dokumentieren, pflegen und archivieren
Mit dem webbasierten Management-System DataAgenda Datenschutz Manager können Sie alle Maßnahmen zum Datenschutz erfassen, verwalten und dokumentieren (VVT, DSFA etc.) und so Ihre Rechenschaftspflicht gemäß DS-GVO erfüllen. Der Referent zeigt, wie Sie mit einem Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten (VVT) gemäß Art. 30 DS-GVO einen zentralen Baustein der Datenschutzdokumentation erstellen. Sie erfahren, wie der DataAgenda Datenschutz Manager
Mehr erfahren -

BSI veröffentlicht Handreichung zur NIS-2-Geschäftsleitungsschulung
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat eine neue Handreichung zur Geschäftsleitungsschulung im Rahmen der NIS-2-Umsetzung veröffentlicht. Die Publikation richtet sich an Führungsebenen von Unternehmen und Einrichtungen, die künftig unter die NIS-2-Regulierung fallen – also als „wichtige“ oder „besonders wichtige Einrichtungen“ gelten. Ziel ist es, Geschäftsleitungen auf ihre neuen Pflichten im Bereich Cybersicherheit
Mehr erfahren -

Refurbished Notebook mit ungelöschten Daten – wer ist verantwortlich?
Der Erwerb gebrauchter oder „refurbished“ IT-Geräte wirft nicht nur technische, sondern auch datenschutzrechtliche Fragen auf. Besonders heikel wird es, wenn auf einem erworbenen Notebook noch personenbezogene Daten des Vorbesitzers vorzufinden sind. Doch wer trägt in diesem Fall die Verantwortung nach der DS-GVO? Verantwortlichenbegriff nach Art. 4 Nr. 7 DS-GVO Nach Art. 4 Nr. 7 DS-GVO
Mehr erfahren



