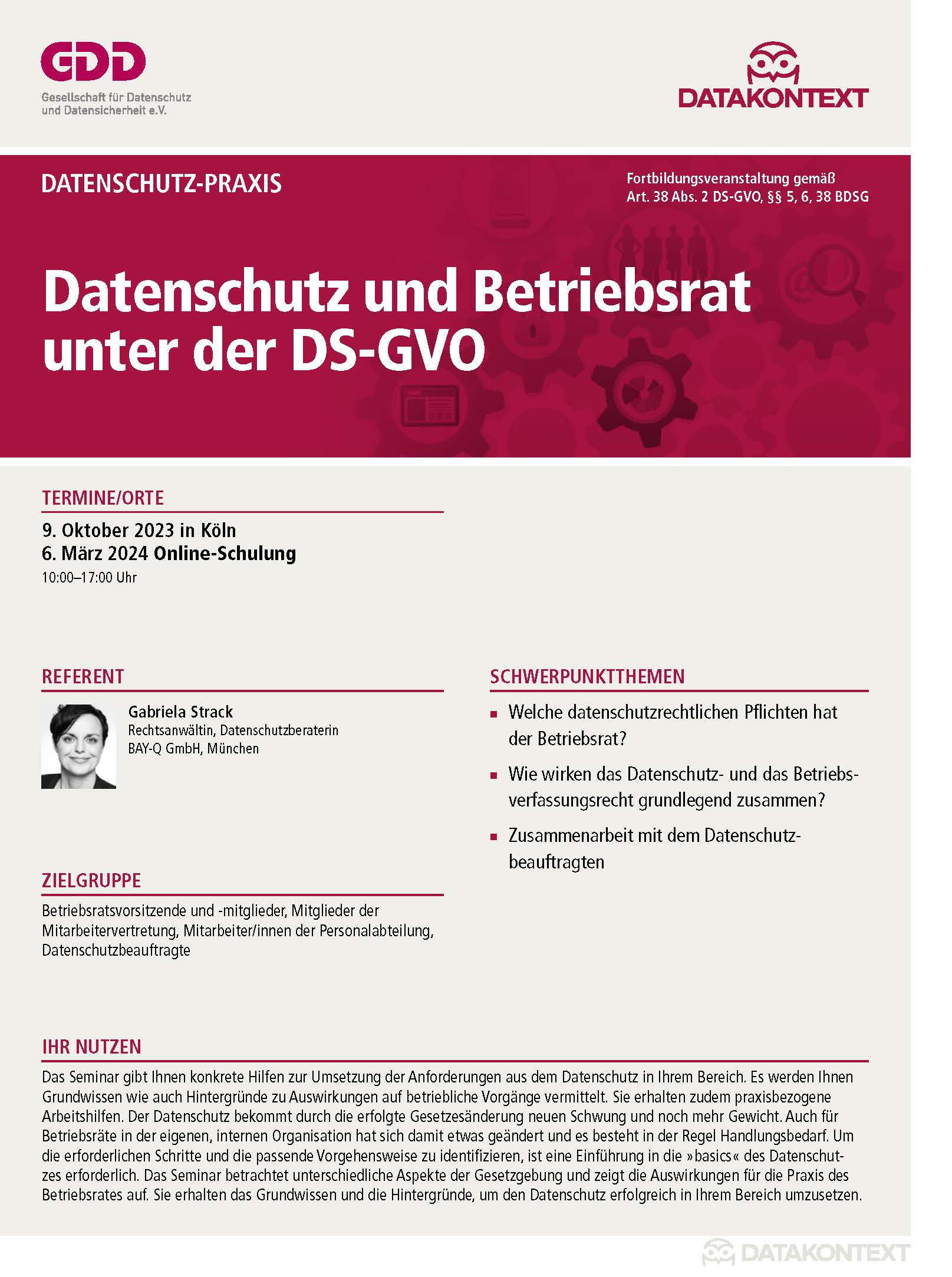Abberufung eines DSB: BAG legt Frage dem EuGH vor

Zur Klärung der Frage, ob die Anforderungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) an die Abberufung eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten im Einklang mit der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) stehen, hat der Neunte Senat des Bundesarbeitsgerichts ein Vorabentscheidungsersuchen an den Gerichtshof der Europäischen Union gerichtet.
Die Parteien streiten über die Wirksamkeit der Bestellung sowie der Abberufung des Klägers zum Datenschutzbeauftragten.
Der Kläger ist Arbeitnehmer der Beklagten und freigestellter Betriebsratsvorsitzender des bei ihr gebildeten Betriebsrats. Daneben ist er stellvertretender Gesamtbetriebsratsvorsitzender in mehreren in Deutschland ansässigen Unternehmen, die zum internationalen X-Konzern gehören, dem auch die Beklagte angehört. Mit Wirkung zum 1.Juni 2015 wurde der Kläger von der Beklagten zum betrieblichen Datenschutzbeauftragten und von den weiteren in Deutschland ansässigen konzernzugehörigen Gesellschaften zum externen Datenschutzbeauftragten bestellt. Ziel seiner Bestellungen war die Erreichung eines konzerneinheitlichen Datenschutzstandards. Im September 2017 meldete der Thüringer Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit gegenüber der Muttergesellschaft der Beklagten wegen der hauptberuflichen Tätigkeit des Klägers als Betriebsratsvorsitzender und dadurch zu befürchtender Interessenkollisionen Zweifel an der Zuverlässigkeit des Klägers als Datenschutzbeauftragter an. In der Folge traf der Thüringer Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit unter Bezugnahme auf § 4f BDSG aF die Feststellung, dass der Kläger nicht über die für die Bestellung eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten notwendige Zuverlässigkeit verfüge und er nicht wirksam zum betrieblichen Datenschutzbeauftragten bestellt worden sei.
–
Mit Schreiben vom 1. Dezember 2017 teilten die Unternehmen, die ihn zum Datenschutzbeauftragten bestellt hatten, dem Kläger mit, dass er wegen der Inkompatibilität der Ämter nicht wirksam zum betrieblichen Datenschutzbeauftragten bestellt worden sei. Hilfsweise widerriefen sie ihre jeweiligen Bestellungen des Klägers zum Datenschutzbeauftragten mit sofortiger Wirkung nach § 4f Abs.3 Satz 4 BDSG aF. Mit Wirkung zum 1.Dezember 2017 bestellten sämtliche Unternehmen eine neue Datenschutzbeauftragte. Nach Inkrafttreten der DSG-VO berief die Beklagte den Kläger im Mai 2018 vorsorglich aus betriebsbedingten Gründen gemäß Art. 38 Abs.3 Satz 2 DS-GVO als Datenschutzbeauftragter ab.
Die Vorinstanzen haben der Klage stattgegeben. Für die Entscheidung, ob die Beklagte den Kläger wirksam von seinem Amt als betrieblicher Datenschutzbeauftragter abberufen hat, komme es auf die Auslegung von Unionsrecht an, die dem Gerichtshof der Europäischen Union vorbehalten sei. Das nationale Datenschutzrecht regele in § 38 Abs. 2 iVm. § 6 Abs. 4 Satz 1 BDSG, dass für die Abberufung eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten ein wichtiger Grund iSv. § 626 BGB vorliegen müsse. Damit knüpfe es die Abberufung eines Datenschutzbeauftragten an strengere Voraussetzungen als das Unionsrecht, nach dessen Art. 38 Abs. 3 Satz 2 DSGVO die Abberufung lediglich dann nicht gestattet sei, wenn sie wegen der Aufgabenerfüllung des Datenschutzbeauftragten vorgenommen werde. Einen wichtigen Grund zur Abberufung verlange das europäische Recht nicht.
Der Neunte Senat des Bundesarbeitsgerichts hält unter Zugrundelegung der bisherigen Rechtsprechung vorliegend keinen wichtigen Abberufungsgrund für gegeben. Deshalb hat er sich nach Art. 267 AEUV mit der Frage an den Gerichtshof gewandt, ob neben der Regelung in Art. 38 Abs. 3 Satz 2 DSGVO mitgliedstaatliche Normen anwendbar sind, die – wie § 38 Abs. 2 iVm. § 6 Abs. 4 Satz 1 BDSG – die Möglichkeit der Abberufung eines Datenschutzbeauftragten gegenüber den unionsrechtlichen Regelungen einschränken. Sollte der EuGH die Anforderungen des BDSG an eine Abberufung für unionsrechtskonform erachten, hält der Senat es zudem für klärungsbedürftig, ob die Ämter des Betriebsratsvorsitzenden und des Datenschutzbeauftragten in einem Betrieb in Personalunion ausgeübt werden dürfen oder ob dies zu einem Interessenkonflikt iSv. Art. 38 Abs. 6 Satz 2 DSGVO führt.
Bundesarbeitsgericht, Beschluss vom 27. April 2021 – 9 AZR 383/19 (A) –
Vorinstanz: Sächsisches Landesarbeitsgericht, Urteil vom 19. August 2019 – 9 Sa 268/18 –
(Foto: Bluedesign – stock.adobe.com)
Letztes Update:27.04.21
Verwandte Produkte
Das könnte Sie auch interessieren
-
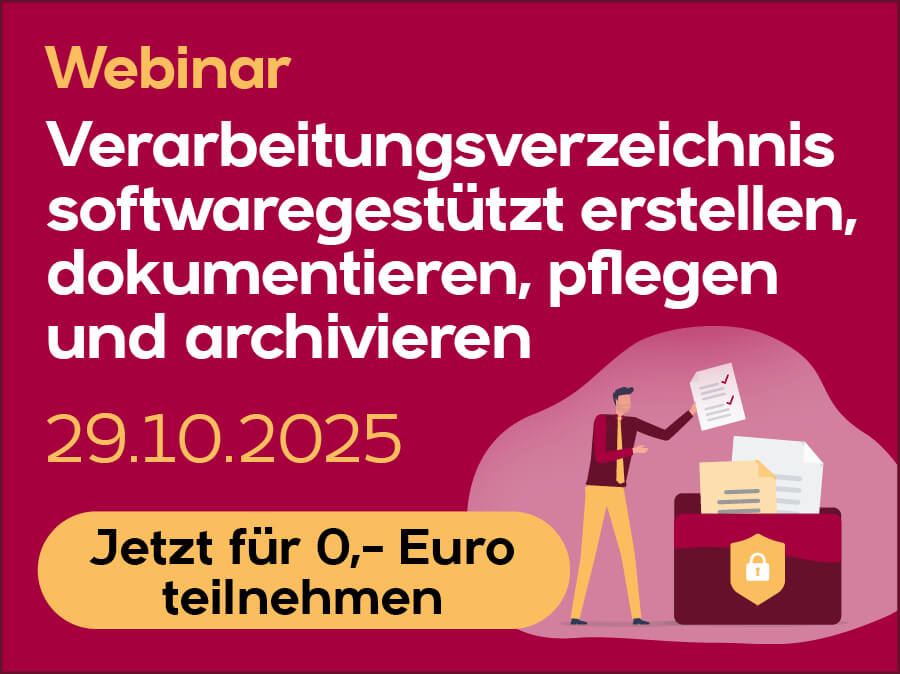
Webinar Verarbeitungsverzeichnis softwaregestützt erstellen, dokumentieren, pflegen und archivieren
Mit dem webbasierten Management-System DataAgenda Datenschutz Manager können Sie alle Maßnahmen zum Datenschutz erfassen, verwalten und dokumentieren (VVT, DSFA etc.) und so Ihre Rechenschaftspflicht gemäß DS-GVO erfüllen. Der Referent zeigt, wie Sie mit einem Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten (VVT) gemäß Art. 30 DS-GVO einen zentralen Baustein der Datenschutzdokumentation erstellen. Sie erfahren, wie der DataAgenda Datenschutz Manager
Mehr erfahren -

BSI veröffentlicht Handreichung zur NIS-2-Geschäftsleitungsschulung
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat eine neue Handreichung zur Geschäftsleitungsschulung im Rahmen der NIS-2-Umsetzung veröffentlicht. Die Publikation richtet sich an Führungsebenen von Unternehmen und Einrichtungen, die künftig unter die NIS-2-Regulierung fallen – also als „wichtige“ oder „besonders wichtige Einrichtungen“ gelten. Ziel ist es, Geschäftsleitungen auf ihre neuen Pflichten im Bereich Cybersicherheit
Mehr erfahren -

Refurbished Notebook mit ungelöschten Daten – wer ist verantwortlich?
Der Erwerb gebrauchter oder „refurbished“ IT-Geräte wirft nicht nur technische, sondern auch datenschutzrechtliche Fragen auf. Besonders heikel wird es, wenn auf einem erworbenen Notebook noch personenbezogene Daten des Vorbesitzers vorzufinden sind. Doch wer trägt in diesem Fall die Verantwortung nach der DS-GVO? Verantwortlichenbegriff nach Art. 4 Nr. 7 DS-GVO Nach Art. 4 Nr. 7 DS-GVO
Mehr erfahren