Auskunftsrecht vs. anwaltliche Verschwiegenheitspflicht

Das Missbrauchspotential des Art. 15 DS-GVO ist recht hoch und viele Fragestellungen im Zusammenhang mit dem Auskunftsrecht scheinen nach wie vor, auch einer gewissen Dynamik innerhalb der Rechtsprechung unterworfen zu sein.
Eine der oftmals in der Praxis anzutreffenden Fragen scheint zu sein, ob das Auskunftsrecht genutzt werden kann, im Rahmen einer juristischen Auseinandersetzung, nützliche Informationen zur eigenen Person vom gegnerischen Anwalt zu erhalten.
In einem von der LfD Sachsen beschriebenen Fall forderte ein in einen Rechtsstreit verwickelte Person vom gegnerischen Rechtsanwalt Auskunft gemäß Art. 15 DS-GVO und forderte die Löschung seiner personenbezogenen Daten. Der Rechtsanwalt reagierte nicht darauf, woraufhin der Bürger bei der LfD Sachsen einreichte.
Nach Prüfung der Rechtslage entschied die LfD wie folgt:
- Der Bürger hat grundsätzlich keinen Anspruch auf Auskunft oder Löschung gegenüber einem gegnerischen Rechtsanwalt.
- Diese Einschränkung des Auskunftsrechts ergibt sich aus Art. 23 Abs. 1 lit. g DS-GVO iVm § 29 Abs. 1 Satz 2 BDSG.
- Demnach ist das Auskunftsrecht ausgeschlossen, wenn durch die Auskunft Informationen preisgegeben würden, die nach einer Rechtsvorschrift geheim gehalten werden müssen, insbesondere solche, die der berufsrechtlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen.
- Diese umfasst grundsätzlich alle Informationen, die einem Rechtsanwalt im Rahmen seiner Berufsausübung bekannt werden (§ 43a Abs. 2 Bundesrechtsanwaltsordnung [BRAO]).
- Ausnahmen gelten nur für offenkundige Tatsachen oder solche, die keiner Geheimhaltung bedürfen, was jedoch selten der Fall ist.
- Selbst die Tatsache, dass personenbezogene Daten bekannt sind, kann im Rahmen eines Mandatsverhältnisses relevant sein und unterliegt der Geheimhaltungspflicht, da der Rechtsanwalt andernfalls seine Berufspflichten verletzen würde.
Fazit:
In einem solchen Fall greift die generelle Regel des § 29 Abs. 1 Satz 2 BDSG, wonach der Auskunftsanspruch keine Informationen umfasst, die der berufsrechtlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen, also alles, was Rechtsanwälten im Rahmen ihrer Berufsausübung bekannt wird (§ 43a Abs. 2 Satz 2 BRAO).
(Foto: WoGi – stock.adobe.com)
Letztes Update:07.07.24
Das könnte Sie auch interessieren
-
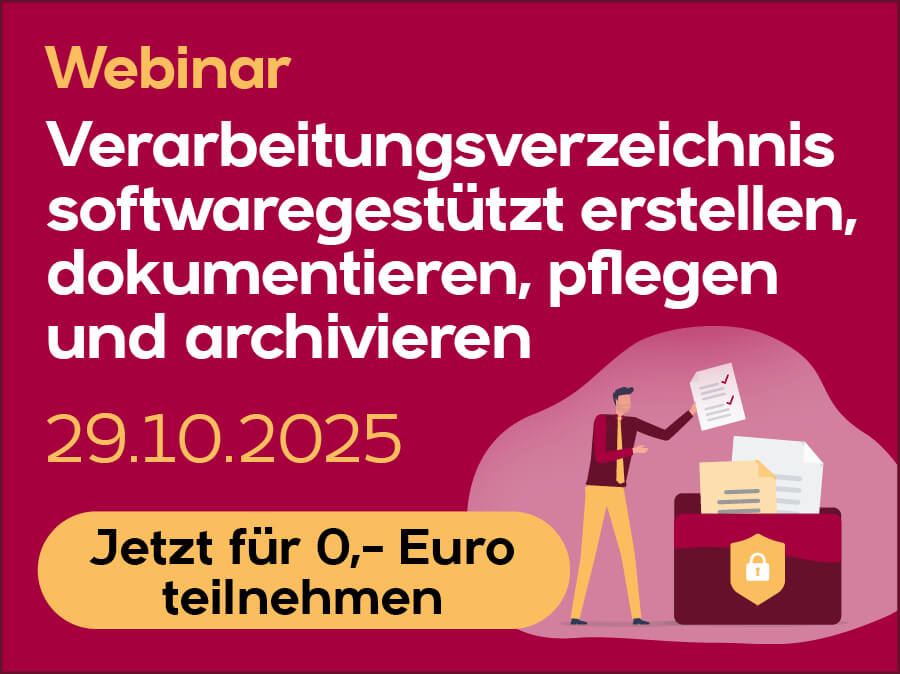
Webinar Verarbeitungsverzeichnis softwaregestützt erstellen, dokumentieren, pflegen und archivieren
Mit dem webbasierten Management-System DataAgenda Datenschutz Manager können Sie alle Maßnahmen zum Datenschutz erfassen, verwalten und dokumentieren (VVT, DSFA etc.) und so Ihre Rechenschaftspflicht gemäß DS-GVO erfüllen. Der Referent zeigt, wie Sie mit einem Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten (VVT) gemäß Art. 30 DS-GVO einen zentralen Baustein der Datenschutzdokumentation erstellen. Sie erfahren, wie der DataAgenda Datenschutz Manager
Mehr erfahren -

BSI veröffentlicht Handreichung zur NIS-2-Geschäftsleitungsschulung
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat eine neue Handreichung zur Geschäftsleitungsschulung im Rahmen der NIS-2-Umsetzung veröffentlicht. Die Publikation richtet sich an Führungsebenen von Unternehmen und Einrichtungen, die künftig unter die NIS-2-Regulierung fallen – also als „wichtige“ oder „besonders wichtige Einrichtungen“ gelten. Ziel ist es, Geschäftsleitungen auf ihre neuen Pflichten im Bereich Cybersicherheit
Mehr erfahren -

Refurbished Notebook mit ungelöschten Daten – wer ist verantwortlich?
Der Erwerb gebrauchter oder „refurbished“ IT-Geräte wirft nicht nur technische, sondern auch datenschutzrechtliche Fragen auf. Besonders heikel wird es, wenn auf einem erworbenen Notebook noch personenbezogene Daten des Vorbesitzers vorzufinden sind. Doch wer trägt in diesem Fall die Verantwortung nach der DS-GVO? Verantwortlichenbegriff nach Art. 4 Nr. 7 DS-GVO Nach Art. 4 Nr. 7 DS-GVO
Mehr erfahren



