BAG bestätigt: DSB und Betriebsratsvorsitzender nicht in Personalunion möglich

Das Ergebnis des BAG-Urteil zu der Frage, ob sich die Tätigkeit eines Datenschutzbeauftragten mit der Tätigkeit eines Betriebsratsvorsitzenden „verträgt“ oder ob diese auf Grund ernstlich anzunehmender Interessenkollsionen miteinander nicht in Einklang gebracht werden können, dürfte die meisten nicht überrascht haben.
In dem vorliegenden Fall wurde der Vorsitzende des Betriebsrats gleichzeitig zum Datenschutzbeauftragten bestellt. Die Arbeitgeberin und ihre Tochtergesellschaften widerriefen jedoch die Bestellung aufgrund einer Inkompatibilität der Ämter. Dies erfolgte auf Veranlassung des Thüringer Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit.
Nach Inkrafttreten der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) wurde der Kläger von der verantwortlichen Stelle vorsorglich mit Schreiben vom 25. Mai 2018 gemäß Art. 38 Abs. 3 Satz 2 DSGVO als Datenschutzbeauftragter abberufen. Der Kläger argumentierte, dass seine Stellung als Datenschutzbeauftragter fortbestehe, während die Arbeitgeberin darauf hinwies, dass Interessenkonflikte zwischen den beiden Ämtern bestünden.
Die Vorinstanzen gaben der Klage statt, aber die Revision des Arbeitgebers vor dem Bundesarbeitsgericht war erfolgreich. Das Gericht entschied, dass der Widerruf der Bestellung aus wichtigem Grund gerechtfertigt war, da ein abberufungsrelevanter Interessenkonflikt vorliegt, wenn der Datenschutzbeauftragte innerhalb einer Einrichtung eine Position bekleidet, die die Festlegung von Zwecken und Mitteln der Verarbeitung personenbezogener Daten zum Gegenstand hat .
Darüber, inwieweit jedes an der Entscheidung mitwirkende Mitglied des Gremiums als Datenschutzbeauftragter die Einhaltung der gesetzlichen Pflichten des Datenschutzes hinreichend unabhängig überwachen kann, hat das BAG in seiner Entscheidung keine abschließende Bewertung getroffen.
Kernaussagen des Gerichts sind:
- Der Vorsitz im Betriebsrat und die Position des Datenschutzbeauftragten können typischerweise nicht von derselben Person ohne Interessenkonflikte ausgeübt werden.
- Personenbezogene Daten dürfen dem Betriebsrat nur zu den Zwecken zur Verfügung gestellt werden, die das Betriebsverfassungsgesetz ausdrücklich vorsieht.
- Die Entscheidung über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung personenbezogener Daten liegt in der Verantwortung des Betriebsrats. Die Funktion des Betriebsratsvorsitzenden beeinträchtigt jedoch die erforderliche Zuverlässigkeit eines Datenschutzbeauftragten gemäß dem BDSG.
(Foto: Song_about_summer – stock.adobe.com)
Letztes Update:14.06.23
Verwandte Produkte
Das könnte Sie auch interessieren
-
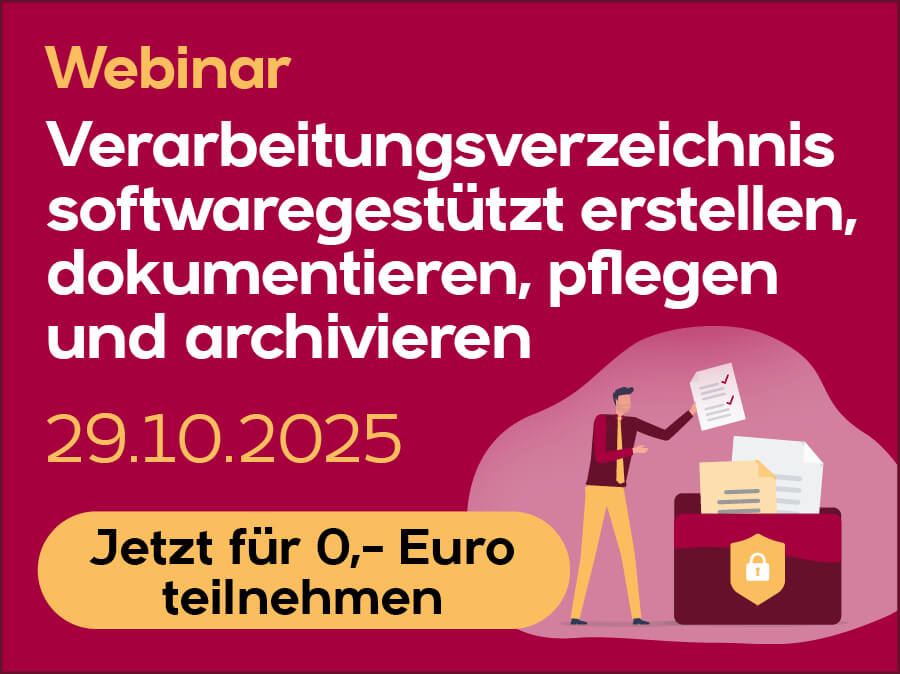
Webinar Verarbeitungsverzeichnis softwaregestützt erstellen, dokumentieren, pflegen und archivieren
Mit dem webbasierten Management-System DataAgenda Datenschutz Manager können Sie alle Maßnahmen zum Datenschutz erfassen, verwalten und dokumentieren (VVT, DSFA etc.) und so Ihre Rechenschaftspflicht gemäß DS-GVO erfüllen. Der Referent zeigt, wie Sie mit einem Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten (VVT) gemäß Art. 30 DS-GVO einen zentralen Baustein der Datenschutzdokumentation erstellen. Sie erfahren, wie der DataAgenda Datenschutz Manager
Mehr erfahren -

BSI veröffentlicht Handreichung zur NIS-2-Geschäftsleitungsschulung
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat eine neue Handreichung zur Geschäftsleitungsschulung im Rahmen der NIS-2-Umsetzung veröffentlicht. Die Publikation richtet sich an Führungsebenen von Unternehmen und Einrichtungen, die künftig unter die NIS-2-Regulierung fallen – also als „wichtige“ oder „besonders wichtige Einrichtungen“ gelten. Ziel ist es, Geschäftsleitungen auf ihre neuen Pflichten im Bereich Cybersicherheit
Mehr erfahren -

Refurbished Notebook mit ungelöschten Daten – wer ist verantwortlich?
Der Erwerb gebrauchter oder „refurbished“ IT-Geräte wirft nicht nur technische, sondern auch datenschutzrechtliche Fragen auf. Besonders heikel wird es, wenn auf einem erworbenen Notebook noch personenbezogene Daten des Vorbesitzers vorzufinden sind. Doch wer trägt in diesem Fall die Verantwortung nach der DS-GVO? Verantwortlichenbegriff nach Art. 4 Nr. 7 DS-GVO Nach Art. 4 Nr. 7 DS-GVO
Mehr erfahren






