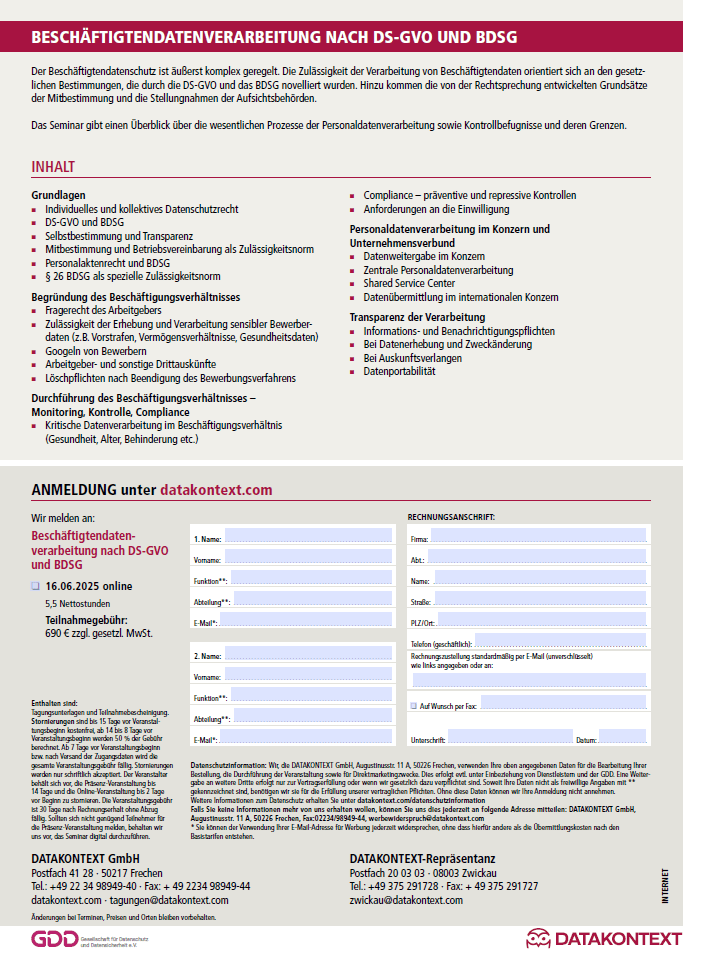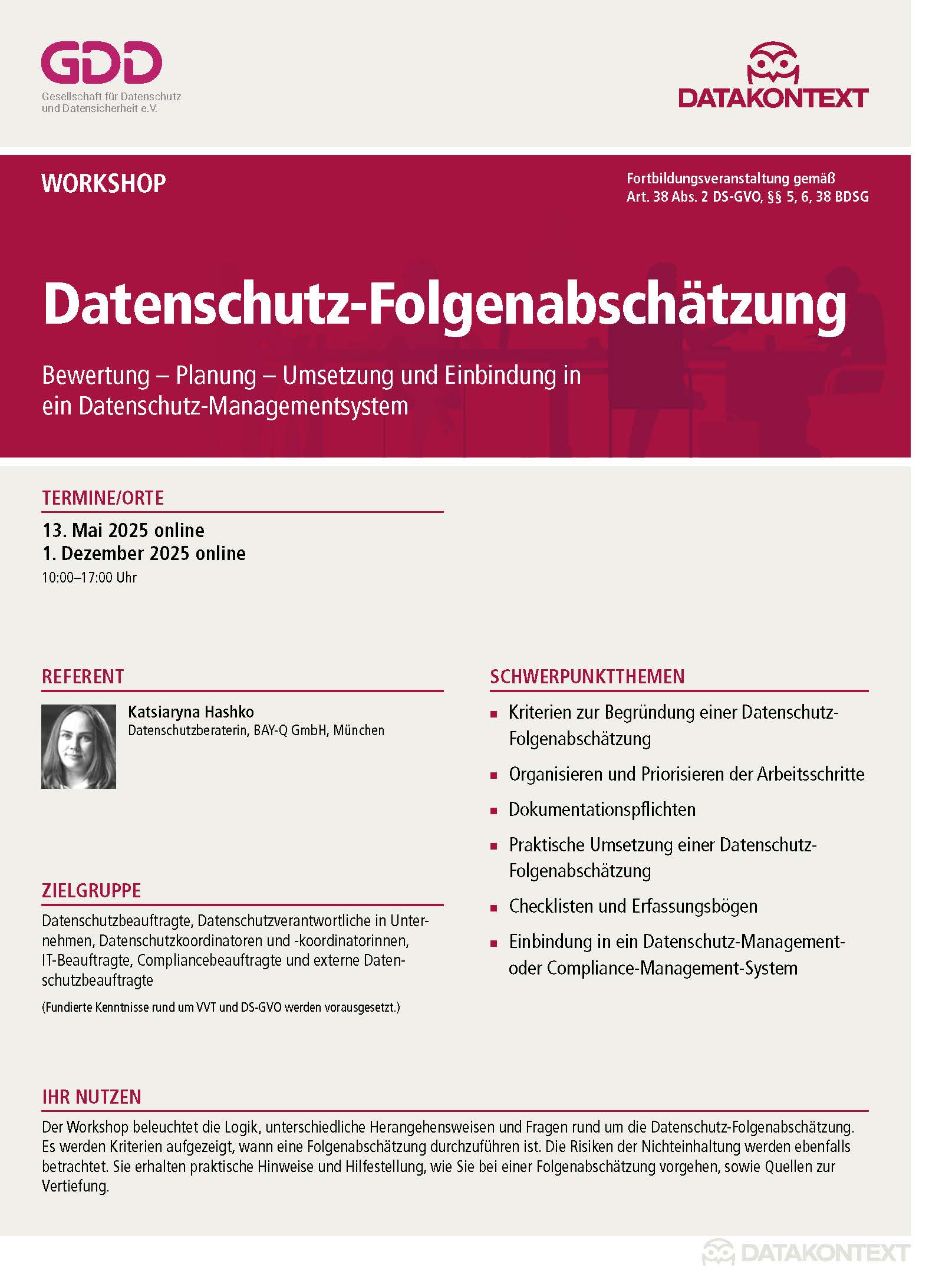Datenschutz bei der Erhebung von Diverstitätsmerkmalen

Vorteile von Diversity
Die Einführung von Diversity, Equity & Inclusion (DEI) in Unternehmen ist nicht nur ein ethisches Gebot, sondern bietet auch handfeste wirtschaftliche Vorteile. Organisationen, die Vielfalt fördern, Gerechtigkeit gewährleisten und Inklusion leben, stärken ihre Innovationskraft, verbessern ihre Wettbewerbsfähigkeit und erhöhen ihre Attraktivität für Talente. Auch wenn diese Ansicht, insbesondere angefeuert durch jüngere Anti-DEI-Maßnahmen aus dem US-amerikanischen Raum, bei ersten Konzernen bereits zu bröckeln scheint, belegen Studien nach wie vor, dass Unternehmen mit vielfältigen Teams bessere (finazielle) Ergebnisse erzielen.
Das scheint auch plausibel: Vielfältige Teams bringen unterschiedliche Perspektiven ein, was zu kreativeren Lösungen und innovativeren Produkten führt. Diverse Gruppen lösen komplexe Probleme effektiver und treffen fundiertere Entscheidungen. Ein inklusives Arbeitsumfeld zieht qualifizierte Fachkräfte an und fördert die Mitarbeiterbindung. Besonders jüngere Generationen, wie Millennials und die Generation Z, bevorzugen Arbeitgeber, die Vielfalt und Inklusion aktiv leben .
Schnittmenge zum Datenschutz
Da Diversitätsmerkmale in der Regel eine Schnittmenge zu den besonderen Kategorien personenbezogener Daten nach Art. 9 DS-GVO haben, sind Diversity-Projekte auch oftmals mit datenschutzrechtlichen Fragestellungen verbunden.
In der Planungsphase von Diversitätsinitiativen sehen sich Unternehmen mit der Frage konfrontiert, ob und in welchem Umfang sie personenbezogene Daten ihrer Beschäftigten zu Diversitätsmerkmalen erheben dürfen. Der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages hat bereits vor einigen Jahren in seinem Sachstandsbericht die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Verarbeitung solcher Daten im Beschäftigungskontext analysiert.
Beschäftigtendatenschutz und Diversity
Grundsätzlich ist das Fragerecht des Arbeitgebers auf Informationen beschränkt, die für das Beschäftigungsverhältnis erforderlich sind. Fragen zu Diversitätsmerkmalen wie ethnischer Herkunft, Religion, sexueller Orientierung oder Behinderung sind nur zulässig, wenn ein berechtigtes Interesse des Arbeitgebers besteht und keine Diskriminierung gemäß dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) vorliegt.
Datenschutzrechtliche Bewertung
Die Erhebung und Verarbeitung von Diversitätsmerkmalen unterliegt den strengen Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO):
- Besondere Kategorien personenbezogener Daten: Daten zu ethnischer Herkunft, Religion, sexueller Orientierung oder Gesundheitszustand gelten als besonders schützenswert (Art. 9 DS-GVO). Ihre Verarbeitung ist nur unter spezifischen Voraussetzungen zulässig, etwa mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person oder wenn sie zur Ausübung von Rechten im Arbeitsrecht erforderlich ist.
- Einwilligung: Eine freiwillige, informierte und spezifische Einwilligung kann eine rechtmäßige Grundlage für die Verarbeitung darstellen. Allerdings bestehen im Beschäftigungsverhältnis Zweifel an der Freiwilligkeit aufgrund des Machtgefälles zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
- Anonymisierung: Die Verarbeitung anonymisierter Daten, bei denen ein Personenbezug ausgeschlossen ist, fällt nicht unter die DS-GVO und kann eine Möglichkeit darstellen, Diversitätsanalysen durchzuführen, ohne personenbezogene Daten zu verarbeiten.
Fazit
Die Erhebung von Diversitätsmerkmalen durch Arbeitgeber ist datenschutzrechtlich nur in engen Grenzen zulässig. Eine Verarbeitung setzt in der Regel eine ausdrückliche Einwilligung der betroffenen Beschäftigten voraus, wobei die Freiwilligkeit im Arbeitsverhältnis kritisch zu prüfen ist. Anonymisierte Datenerhebungen können eine datenschutzkonforme Alternative darstellen. Unternehmen sollten sorgfältig abwägen, ob und in welchem Umfang sie Diversitätsdaten erheben, und dabei die rechtlichen Vorgaben strikt einhalten.
Nachtrag
- In der Regel werden Diversity-Projekte mit personenbezogenen Daten , die einen Bezug zu Art.9-DS-GVO haben DSFA-pflichtig sein.
- Die Legitimierung der Datenverarbeitung wird in der Regel nicht über die Interessenabwägung des Art. 6 Abs.1 lit. f) DS-GVO möglich sein, da dieser hierfür gesperrt ist.
- Bei einem Vorhaben, Diversitätsmerkmale anonymisiert verarbeiten zu wollen, sollte beachtet werden, dass einige Aufsichtsbehörden eine spezielle Rechtsauffassung hierzu haben. Nach Auffassung des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) stellt der Vorgang der Anonymisierung bspw. selbst eine rechtfertigungsbedürftige Verarbeitung im Sinne des Art. 4 Nr. 2 DS-GVO dar. Dieser Ansicht wird allerdings im Schrifttum widersprochen
Letztes Update:28.04.25
Verwandte Produkte
Das könnte Sie auch interessieren
-

Folge 83: Psychologie im Spiegel der KI
Die Haltung der Menschen zu KI wandelt sich nach dem Befund des Psychologen Stephan Grünewald. Aus dem Zauberstab des „Allmachts-Boosters“ sei eine Bedrohung geworden. KI sei zwischen „persönlichem Heinzelmann und gefügigem Traumpartner“ gestartet: „Was kann ich noch selbst? Und wer bin ich überhaupt noch?“. Diese Fragen stellen sich für den Menschen. Wie hätte man vor
Mehr erfahren -

Folge 86: KI-Daten-Wirtschaft – Der Parlamentarische Abend der GDD im Rückblick
Im Dezember 2025 hat die GDD zum Parlamentarischen Abend in der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft in Berlin eingeladen. Unter der Schirmherrschaft von MdB Günter Krings haben Thomas Jarzombek, Parlamentarischer Staatssekretär im BMDS, Dr. Daniela Brönstrup, Vizepräsidentin der BNetzA, und DSK-Chef Tobias Keber, VAUNET-Chef Claus Grewenig, der Neuropathologe Felix Sahm und Kristin Benedikt diskutiert, moderiert von Rolf
Mehr erfahren -

EuGH: Banken haften auch ohne Verurteilung ihrer Organmitglieder
Der Europäische Gerichtshof hat mit Urteil vom 29. Januar 2026 (C-291/24) entschieden, dass die EU-Geldwäscherichtlinie einer nationalen Regelung entgegensteht, die Sanktionen gegen juristische Personen von der förmlichen Feststellung der Schuld natürlicher Personen abhängig macht. Das Urteil stärkt die Durchsetzbarkeit von Compliance-Anforderungen im Finanzsektor. Ausgangssachverhalt aus Österreich Die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) hatte gegen die Steiermärkische Bank
Mehr erfahren