Drittlandtransfer: Gleichsetzung von Zugriffsrisiko und Übermittlung?

Der Beschluss der Vergabekammer Baden-Württemberg (Az. 1 VK 23/22) vom 13. Juli 2022 adressiert u.a. auch die Frage, ob US-Anbieter digitaler Server- und Cloud-Leistungen ihre Dienstleistungen über europäische Tochtergesellschaften erbringen können. Die Vergabekammer scheint davon auszugehen, dass eine Zusammenarbeit mit US-Anbietern nach Wegfall des Privacy-Shields-Abkommens mit der EU (vgl. EuGH, Urteil vom 16. Juli 2020 – Az. C-311/18; „Schrems-II“) trotz der Verwendung sog. Standarddatenschutzklauseln per se unzulässig ist.
Der Beschluss führte auf Blogs und Sozialen Medien zu kontroversen Diskussionen. Auch der LfDI Baden-Württemberg fühlte sich auf den Plan gerufen und schaltete sich in dieser Fragestellung mit einer ausführlichen Stellungnahme ein.
Der LfDI merkte an, dass zum einen das Verfahren Klauseln zum Prüfungsgegenstand hatte, die aus Sicht der Vergabekammer noch hinter den Anforderungen der aktuell einsetzbaren Standarddatenschutzklauseln zurückbleiben. Noch deutlicher und kritischer wird der LfDI, wenn er anmerkt, dass die von der Vergabekammer vorgenommene Gleichsetzung von Zugriffsrisiko und Übermittlung (als Verarbeitungsform nach Art. 4 Nr. 2 DS-GVO) als rechtlich zweifelhaft einzustufen sein dürfte.
Dass ein Zugriffsrisiko ohne weiteres einen Übermittlungstatbestand erfülle, könne mit guten Gründen bestritten werden. Dass die DS-GVO einen „risikobasierten Ansatz“ zugunsten Verantwortlicher eingeführt habe, werde von interessierten Kreisen zwar immer wieder (und in dieser Pauschalität wenig überzeugend) vorgebracht. Dass dieser Ansatz jetzt aber zu Lasten von Verantwortlichen und Auftragsverarbeitern umgedreht werden dürfte, überzeuge wenig.
Die wesentliche Argumentation der Vergabekammer im Wortlaut ist wie folgt:
„Allein die Möglichkeit, dass auf personenbezogene Daten durch die nichteuropäische Muttergesellschaft zugegriffen werden kann, führt zu einer sog. „Weitergabe“ im Sinne der DSGVO, dies unabhängig davon, ob ein solcher Zugriff durch die US-Muttergesellschaft tatsächlich erfolgt. Diese Weitergabe ist nach Ansicht der Vergabekammer nach Wegfall des US-Privacy-Shields unzulässig, sie konnte in dem Verfahren insbesondere nicht durch den Abschluss von Standardvertragsklauseln (sog. SCC’s) legitimiert werden.
Der LfDI macht auch auf einen anderen Schwachpunkt in der Argumentation der Vergabekammer aufmerksam:
Die Vergabekammer übersehe, dass gegen solche Zugriffsrisiken wirksame Gegenmittel in Gestalt sog. „technisch-organisatorischer Maßnahmen“ existieren, die letztlich jedes Risiko ausschließen könnten. Gerade dieser Aspekt wurde aber von der Vergabekammer überhaupt nicht betrachtet, so der LfDI.
(Foto: N. Theiss – stock.adobe.com)
Letztes Update:25.08.22
Verwandte Produkte
Das könnte Sie auch interessieren
-
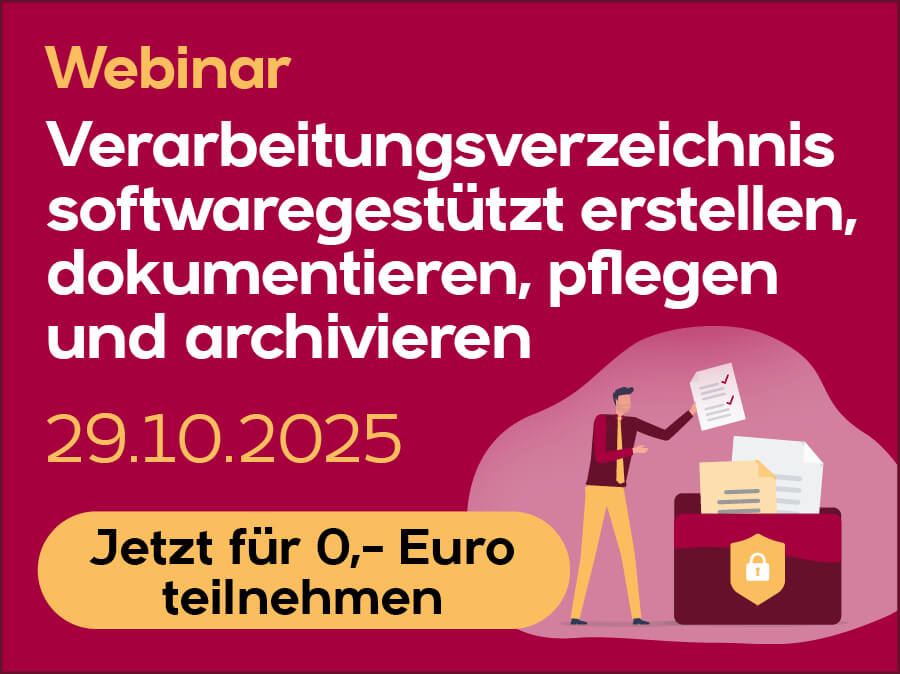
Webinar Verarbeitungsverzeichnis softwaregestützt erstellen, dokumentieren, pflegen und archivieren
Mit dem webbasierten Management-System DataAgenda Datenschutz Manager können Sie alle Maßnahmen zum Datenschutz erfassen, verwalten und dokumentieren (VVT, DSFA etc.) und so Ihre Rechenschaftspflicht gemäß DS-GVO erfüllen. Der Referent zeigt, wie Sie mit einem Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten (VVT) gemäß Art. 30 DS-GVO einen zentralen Baustein der Datenschutzdokumentation erstellen. Sie erfahren, wie der DataAgenda Datenschutz Manager
Mehr erfahren -

BSI veröffentlicht Handreichung zur NIS-2-Geschäftsleitungsschulung
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat eine neue Handreichung zur Geschäftsleitungsschulung im Rahmen der NIS-2-Umsetzung veröffentlicht. Die Publikation richtet sich an Führungsebenen von Unternehmen und Einrichtungen, die künftig unter die NIS-2-Regulierung fallen – also als „wichtige“ oder „besonders wichtige Einrichtungen“ gelten. Ziel ist es, Geschäftsleitungen auf ihre neuen Pflichten im Bereich Cybersicherheit
Mehr erfahren -

Refurbished Notebook mit ungelöschten Daten – wer ist verantwortlich?
Der Erwerb gebrauchter oder „refurbished“ IT-Geräte wirft nicht nur technische, sondern auch datenschutzrechtliche Fragen auf. Besonders heikel wird es, wenn auf einem erworbenen Notebook noch personenbezogene Daten des Vorbesitzers vorzufinden sind. Doch wer trägt in diesem Fall die Verantwortung nach der DS-GVO? Verantwortlichenbegriff nach Art. 4 Nr. 7 DS-GVO Nach Art. 4 Nr. 7 DS-GVO
Mehr erfahren




