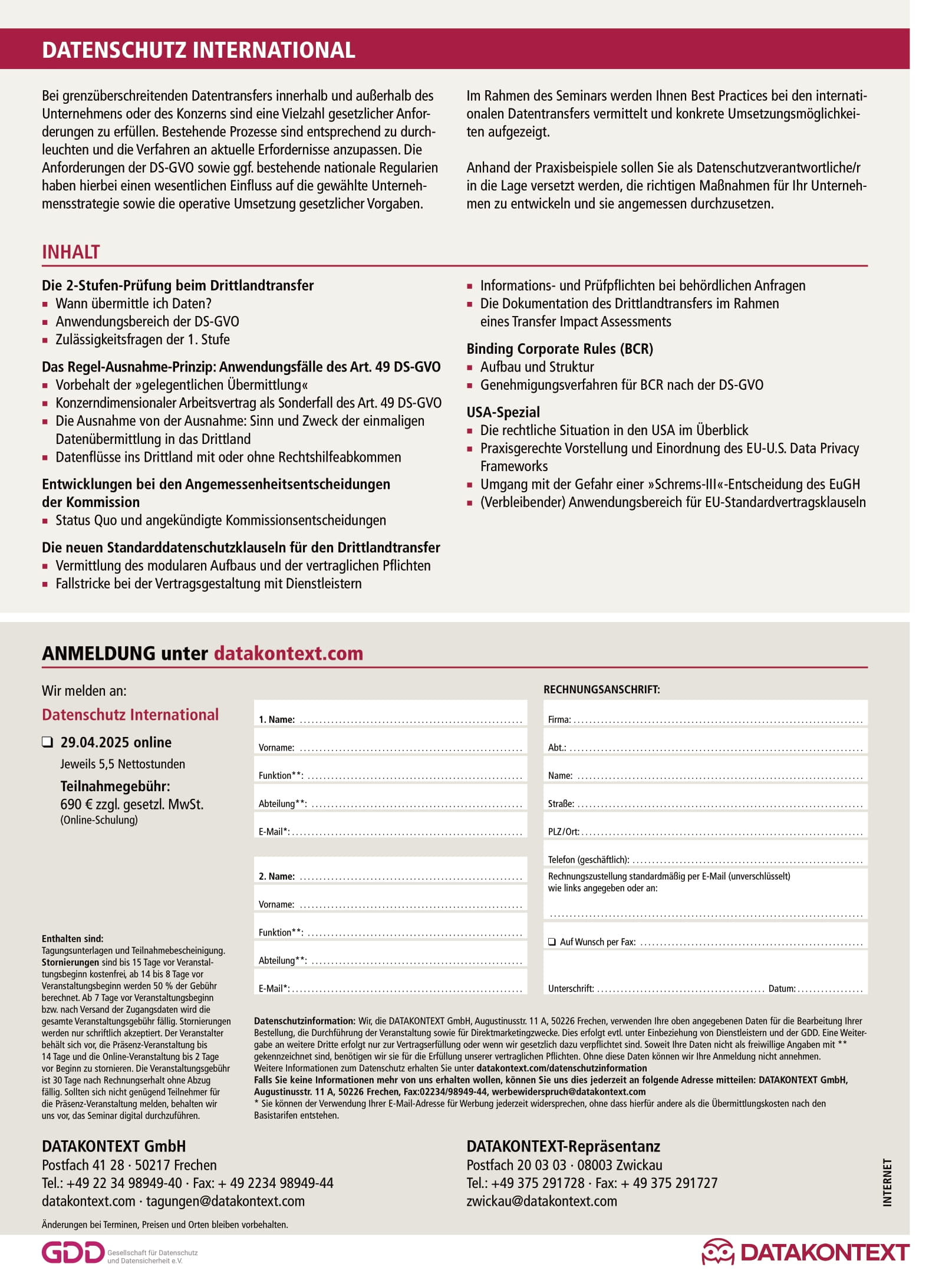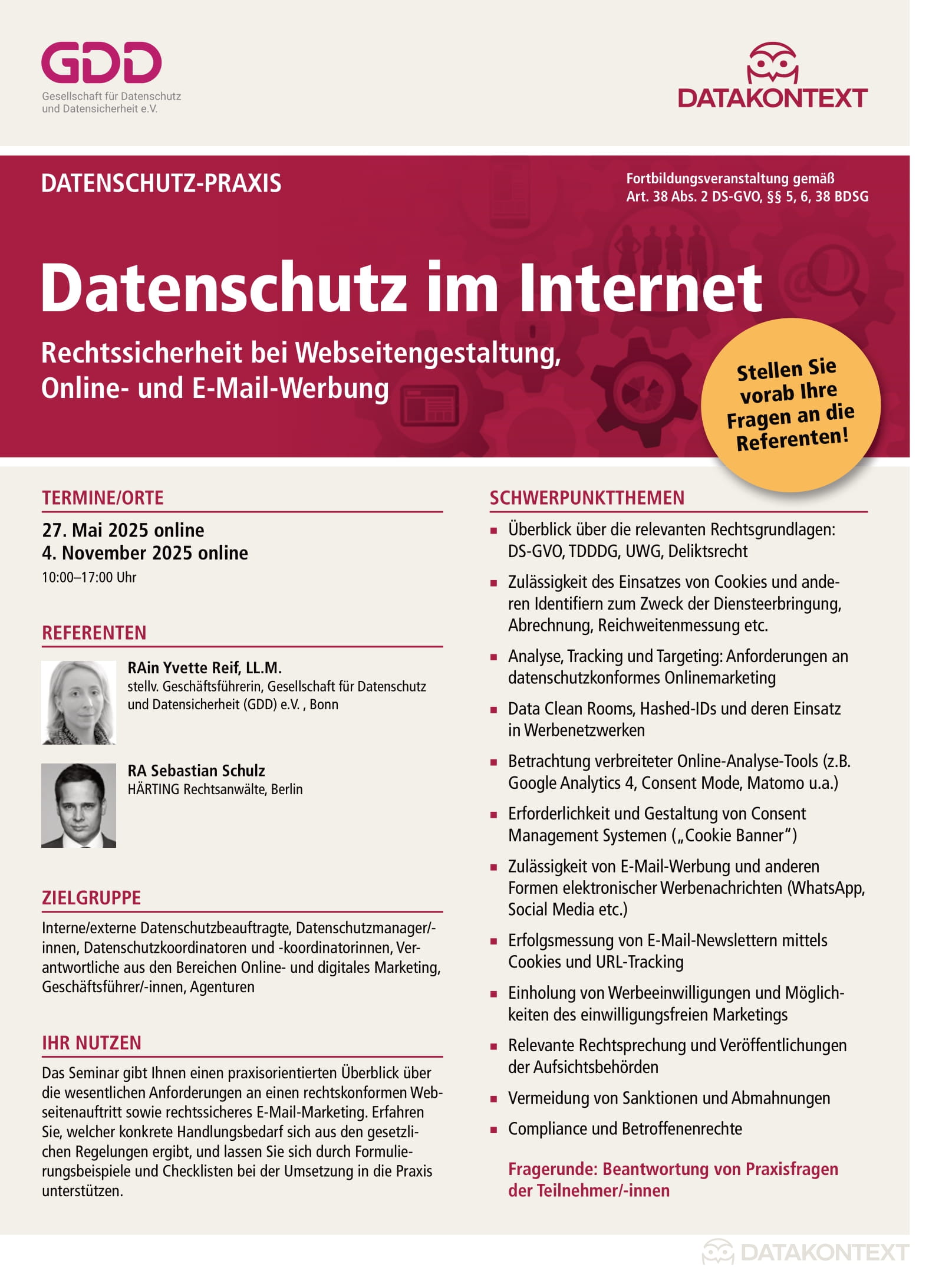EuGH: Erhebung von Anrede-Daten nicht zwingend erforderlich
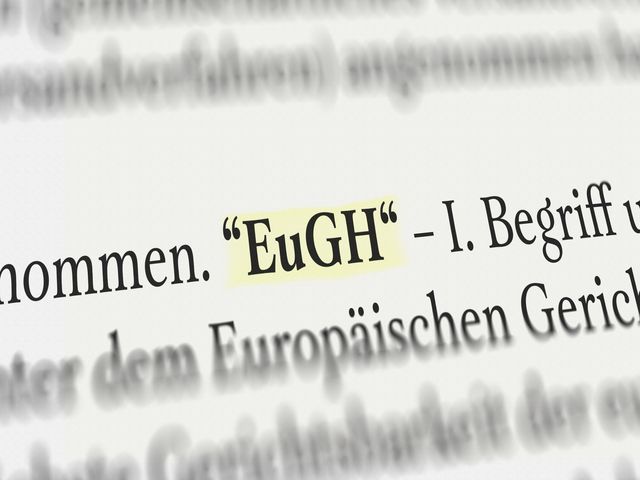
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat entschieden, dass die Erhebung von Anrede-Daten („Herr“ oder „Frau“) durch Unternehmen im Rahmen der geschäftlichen Kommunikation nicht zwingend erforderlich ist. Dies gilt auch dann, wenn die Angabe zur Personalisierung der Kundenansprache dient. Die Praxis kann gegen den Grundsatz der Datenminimierung gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verstoßen (EuGH, Urteil vom 9. Januar 2025, C-394/23).
Hintergrund des Falls
Das französische Eisenbahnunternehmen SNCF Connect fordert beim Online-Ticketkauf die Angabe einer Anrede. Ein Verband kritisierte dies als Verstoß gegen die DSGVO, insbesondere gegen den Grundsatz der Datenminimierung, da die Anrede keinen Bezug zur eigentlichen Vertragserfüllung habe. Die französische Datenschutzbehörde CNIL wies die Beschwerde zurück und sah in der Praxis keinen DSGVO-Verstoß. Der Fall wurde daraufhin dem EuGH vorgelegt.
Entscheidung des EuGH
Der EuGH stellte klar, dass personenbezogene Daten gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. c DSGVO nur in dem Umfang erhoben und verarbeitet werden dürfen, der für den jeweiligen Zweck erforderlich ist. Eine Datenverarbeitung ist insbesondere dann rechtmäßig, wenn:
- Die Verarbeitung für die Vertragserfüllung unerlässlich ist, oder
- Ein berechtigtes Interesse des Verantwortlichen vorliegt, das die Grundrechte der betroffenen Personen nicht überwiegt.
1. Keine Erforderlichkeit für die Vertragserfüllung
Die Anrede ist nach Auffassung des EuGH nicht objektiv unerlässlich für den Abschluss oder die Durchführung eines Schienenverkehrsvertrags. Die geschäftliche Kommunikation könne auch ohne Anrede erfolgen, beispielsweise durch geschlechtsneutrale Höflichkeitsformeln.
2. Kein überwiegendes berechtigtes Interesse
Der EuGH betont, dass Unternehmen ihre berechtigten Interessen klar kommunizieren und deren Notwendigkeit begründen müssen. Eine Datenverarbeitung zur geschäftlichen Personalisierung kann nicht als erforderlich gelten, wenn:
- Das berechtigte Interesse den Kunden nicht transparent mitgeteilt wurde,
- Die Verarbeitung über das absolut Notwendige hinausgeht,
- Die Grundrechte und Grundfreiheiten der Betroffenen überwiegen, insbesondere wenn Diskriminierung aufgrund der Geschlechtsidentität möglich ist.
Fazit
Unternehmen sollten bei der Erhebung von Anrede-Daten kritisch prüfen, ob diese für ihre Geschäftszwecke wirklich erforderlich sind. Der EuGH macht deutlich, dass geschlechtsneutrale Kommunikationsformen eine datensparsamere und rechtlich sicherere Alternative darstellen können.
(Foto: Nico – stock.adobe.com)
Letztes Update:03.03.25
Verwandte Produkte
-
Datenschutz-Repetitorium zum GDDcert EU: Vorbereitung auf die GDDcert. EU-Prüfung
Seminar
773,50 € Mehr erfahren
Das könnte Sie auch interessieren
-

Folge 83: Psychologie im Spiegel der KI
Die Haltung der Menschen zu KI wandelt sich nach dem Befund des Psychologen Stephan Grünewald. Aus dem Zauberstab des „Allmachts-Boosters“ sei eine Bedrohung geworden. KI sei zwischen „persönlichem Heinzelmann und gefügigem Traumpartner“ gestartet: „Was kann ich noch selbst? Und wer bin ich überhaupt noch?“. Diese Fragen stellen sich für den Menschen. Wie hätte man vor
Mehr erfahren -

Folge 86: KI-Daten-Wirtschaft – Der Parlamentarische Abend der GDD im Rückblick
Im Dezember 2025 hat die GDD zum Parlamentarischen Abend in der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft in Berlin eingeladen. Unter der Schirmherrschaft von MdB Günter Krings haben Thomas Jarzombek, Parlamentarischer Staatssekretär im BMDS, Dr. Daniela Brönstrup, Vizepräsidentin der BNetzA, und DSK-Chef Tobias Keber, VAUNET-Chef Claus Grewenig, der Neuropathologe Felix Sahm und Kristin Benedikt diskutiert, moderiert von Rolf
Mehr erfahren -

EuGH: Banken haften auch ohne Verurteilung ihrer Organmitglieder
Der Europäische Gerichtshof hat mit Urteil vom 29. Januar 2026 (C-291/24) entschieden, dass die EU-Geldwäscherichtlinie einer nationalen Regelung entgegensteht, die Sanktionen gegen juristische Personen von der förmlichen Feststellung der Schuld natürlicher Personen abhängig macht. Das Urteil stärkt die Durchsetzbarkeit von Compliance-Anforderungen im Finanzsektor. Ausgangssachverhalt aus Österreich Die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) hatte gegen die Steiermärkische Bank
Mehr erfahren