Kein Auskunftsanspruch gem. Art. 15 DS-GVO bei Rechtsmissbrauch

Eine der Fragen im Zusammenhang mit Art. 15 DS-GVO, die der Praxis „auf den Nägeln brennt“ und oft Anlass für Streitigkeiten bietet, ist die Frage des „Rechtsmissbrauchs“ iVm mit Auskunftsbegehren.
In der Praxis wird häufig der Anspruch auf Auskunft genutzt, um Informationen zu erhalten, die legitime Zwecke darstellen, jedoch nicht im Zusammenhang mit dem Datenschutz stehen. Diese Informationen werden dann verwendet, um beispielsweise unrechtmäßig erhobene Bankgebühren oder zu Unrecht gezahlte Versicherungsprämien zurückzufordern.
Die Frage, ob ein solcher Auskunftsanspruch, der nicht dem Datenschutz dient, sondern anderen rechtmäßigen Zielen, rechtsmissbräuchlich ist und daher vom Verantwortlichen abgelehnt werden kann, ist in der Rechtsprechung umstritten. Der Bundesgerichtshof hat diese Frage dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) zur Vorabentscheidung vorgelegt (BGH, EuGH-Vorlage vom 29. März 2022 – VI ZR 1352/20 –). In diesem Beschluss hat der Bundesgerichtshof auch Zweifel geäußert, ob in solchen Fällen tatsächlich ein Rechtsmissbrauch vorliegt, da der Wortlaut von Artikel 15 der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) eine solche Beschränkung nicht enthält.
Das OLG Hamm (Oberlandesgericht Hamm, Urteil vom 03.05.2023, Az. 20 U 146/22) hat sich in einem aktuellen Urteil ebenfalls zu der Frage der Rechtsmissbräcuhlichkeit eines Auskunftsbegehrens nach Art. 15 DS-GVO geäußert. Im Kern streiten die Parteien über Prämienanpassungen im Rahmen einer vom Kläger bei der Beklagten seit dem 01.07.1989 gehaltenen privaten Krankenversicherung.
Das Gericht stellt in seiner Urteilsbegründung fest, dass der geltend gemachte Auskunftsanspruch sich nicht aus Art. 15 Abs. 1 DS-GVO ergibt.
Das Gericht bestätigt zwar, dass zumindest einzelne der vom Kläger mit dem Auskunftsbegehren verlangten Informationen zwar personenbezogene Daten im Sinne von Art. 4 Abs. 1 DS-GVO sind. Der Beklagten stehe aber ein Weigerungsrecht aus Art. 12 Abs. 5 Satz 2 Buchstabe b) DS-GVO zu. Die Vorschrift führe zwar lediglich die häufige Wiederholung als Beispiel für einen „exzessiven“ Antrag auf. Die Verwendung des Wortes „insbesondere“ mache aber deutlich, dass die Vorschrift auch andere rechtsmissbräuchliche Anträge erfassen will (vgl. Heckmann/Paschke, in Ehmann/Selmayr, Datenschutz-Grundverordnung 2. Auflage 2018, Art. 12 Rn. 43).
Bei der Auslegung, was in diesem Sinne rechtsmissbräuchlich ist, sei auch der Schutzzweck der DS-GVO zu berücksichtigen. Wie sich aus dem Erwägungsgrund 63 zu der Verordnung ergebe, sei Sinn und Zweck des in Art. 15 DS-GVO normierten Auskunftsrechts, es der betroffenen Person problemlos und in angemessenen Abständen zu ermöglichen, sich der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten bewusst zu werden und die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung überprüfen zu können (so auch BGH, Urteil vom 15.06.2021, VI ZR 576/19, VersR 2021, 1019 ff. Rn. 23).
Um ein solches Bewusstwerden zum Zweck einer Überprüfung der datenschutzrechtlichen Zulässigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten gehe es dem Kläger aber nach seinem eigenen Klagevorbringen überhaupt nicht. Sinn und Zweck der von ihm begehrten Auskunftserteilung sei vielmehr – wie sich aus der Koppelung mit dem unzulässigen Antrag auf Zahlung zweifelsfrei ergebe – ausschließlich die Überprüfung etwaiger von der Beklagten vorgenommener Prämienanpassungen wegen möglicher formeller Mängel nach § 203 Abs. 5 VVG. Eine solche Vorgehensweise ist vom Schutzzweck der DS-GVO aber nicht umfasst (ebenso OLG Nürnberg, Urteil vom 14.03.2022, 8 U 2907/21, VersR 2022, 622 ff., Rn. 43; s. auch OLG München, Beschluss vom 24.11.2021, 14 U 6205/21, r+s 2022, 94 f., Rn. 55 f.).
Ginge es einem Kläger auch um die von Art. 15 Abs. 1, 3 DS-GVO geschützten Interessen, mögen daneben auch verfolgte Zwecke einem Anspruch nicht entgegenstehen, so das Gericht. Werde das datenschutzrechtliche Interesse aber erkennbar gar nicht verfolgt oder nur vorgeschoben, bestehen die von der vorherigen Instanz angenommenen Abgrenzungsschwierigkeiten nicht.
(Foto: qOppi – stock.adobe.com)
Letztes Update:06.07.23
Verwandte Produkte
Das könnte Sie auch interessieren
-

LinkedIn-Verrnetzung begründet keine Einwilligung für Werbe‑E‑Mails
Das AG Düsseldorf hat mit Urteil vom 20.11.2025 (Az. 23 C 120/25) klargestellt, dass berufliche Vernetzung in sozialen Netzwerken keine Einwilligung für den Versand werblicher E-Mails begründet. Hintergrund war ein Fall, in dem ein IT-Dienstleister zwei Werbe-E-Mails an eine GmbH sandte, die lediglich über LinkedIn vernetzt war, ohne dass eine ausdrückliche Zustimmung vorlag. LinkedIn-Kontakte ≠ Einwilligung für
Mehr erfahren -

Vergütung für nicht deklariertes „KI-Gutachten“ kann verweigert werden
Das Landgericht Darmstadt hat in einem Beschluss vom November 2025 (19 O 527/16) klargestellt, dass eine erhebliche, nicht gegenüber dem Gericht offengelegte Verwendung von Künstlicher Intelligenz (KI) bei der Erstellung eines gerichtlichen Sachverständigengutachtens zur vollständigen Versagung der Vergütung führen kann. Damit stärkt das Gericht die Anforderungen an Transparenz, persönliche Leistungspflicht und Nachvollziehbarkeit bei Gutachten, die im Rahmen zivilprozessualer
Mehr erfahren -
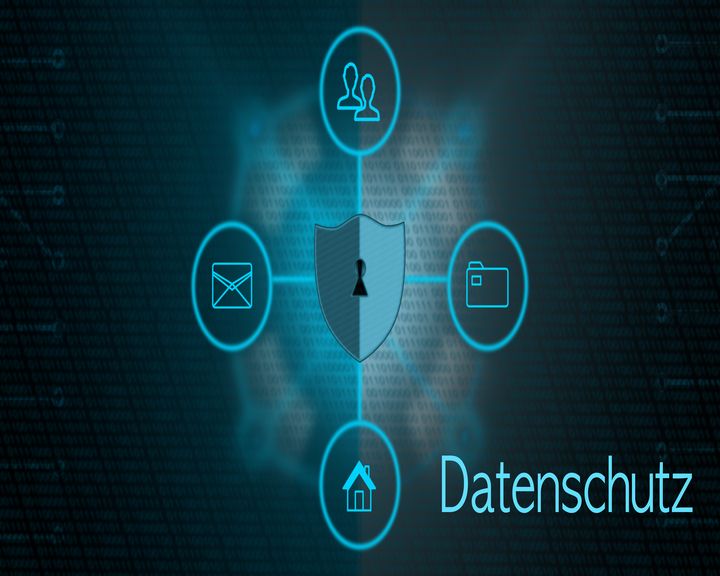
Gemeinsame Dateiablagen als datenschutzrechtliches Risiko
In der Aktuellen Kurz-Information 65 weist der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz auf die erhebliche Gefahr von Datenpannen durch gemeinsam genutzte Dateiablagen hin. Betroffen sind sowohl klassische Netzlaufwerke als auch moderne Kollaborationsplattformen wie Microsoft SharePoint. Diese Systeme dienen zwar der effizienten Zusammenarbeit, können jedoch bei unzureichender Konfiguration und Organisation zu unbeabsichtigten Offenlegungen personenbezogener Daten führen.
Mehr erfahren




