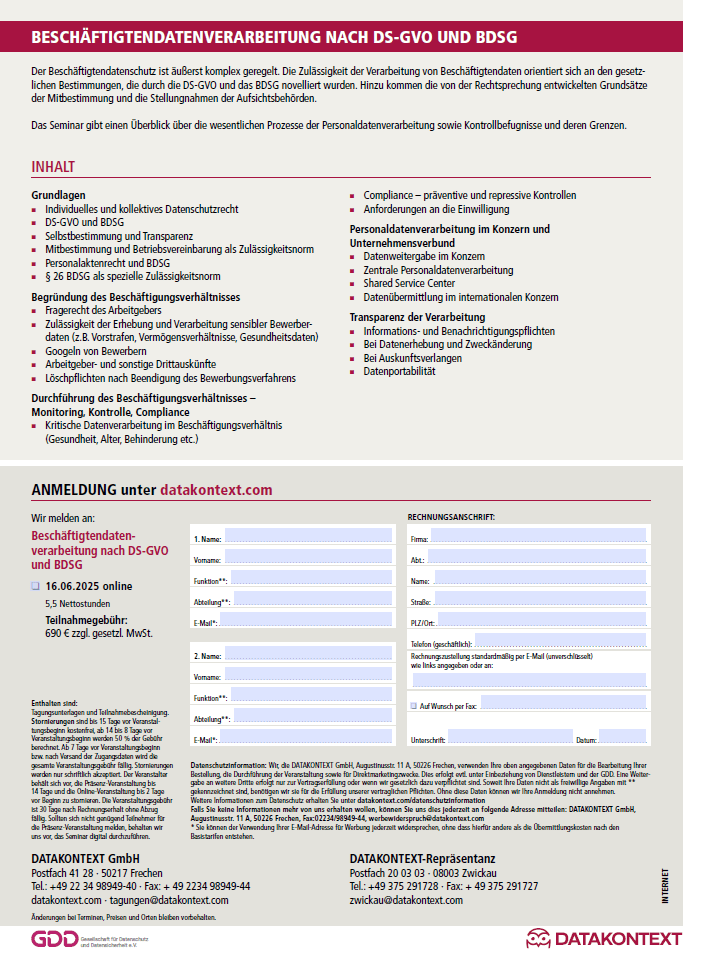Unterstützungspflicht des Betriebsrats bei Auskunftsbegehren nach Art. 15 DS-GVO

Nach der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) haben betroffene Personen das Recht, von Verantwortlichen Auskunft über die Verarbeitung ihrer Daten zu erhalten. Dieses Auskunftsrecht ist von großer Bedeutung, da nur wer über die Verarbeitung seiner Daten informiert ist, weitere Rechte wie Berichtigung, Löschung oder Schadenersatz in Anspruch nehmen kann.
Im Kontext des Beschäftigtendatenschutzrechts sind etwaige Datensammlungen, die (auch) beim Betriebsrat über die betroffenen Beschäftigten vorliegen könnnen, ebenfalls Teilmenge der zu beauskunftenden Gesamtinformation. Ob aus Unkenntnis oder anderen ggf. (strategischen) Motiven – es scheint in der betrieblichen Praxis nicht allzuselten vorzukommen, dass dem Betriebsrat die Einsicht/Kenntnis fehlt, dass er hier Mitwirkungspflichten hat.
Das BayLDA gibt in seinem aktuellen Tätigkeitsbericht (14. Tätigkeitsbericht 2024, Ziffer 9.2) einige Empfehlungen, wie Verantwortliche (Arbeitgeber) eine solche Situation lösen können.
Spoiler – Sofern ein Datenschutzbeauftragter vorhanden ist, kann er wie so oft wichtiger Teil der Lösung sein:
Gemäß § 79a BetrVG ist der Betriebsrat verpflichtet, den Arbeitgeber bei der Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorschriften zu unterstützen.
Kernprobleme und Lösungsansätze:
- Der Arbeitgeber bleibt auch dann Verantwortlicher für die Datenverarbeitung, wenn der Betriebsrat personenbezogene Daten verarbeitet (§ 79a S. 2 BetrVG).
- Bei Auskunftsersuchen nach Art. 15 DS-GVO müssen auch Datenverarbeitungen des Betriebsrats berücksichtigt werden. Einige Betriebsräte verweigern jedoch die Mitwirkung unter Verweis auf ihre Verschwiegenheitspflicht.
- Eine pragmatische Lösung besteht darin, dass entweder der Betriebsrat selbst die (Teil-)Auskunft erteilt oder die bzw. der Datenschutzbeauftragte als neutrale Instanz eingebunden wird (§ 79a S. 4 BetrVG).
So bestimmt § 79a BetrVG in Satz 4, dass die oder der Datenschutzbeauftragte gegenüber dem Arbeitgeber zur Verschwiegenheit verpflichtet ist über Informationen, die Rückschlüsse auf den Meinungsbildungsprozess des Betriebsrats zulassen. Die oder der Datenschutzbeauftragte ist somit nicht für ein „Lager“ beratend und unterstützend tätig, sondern kann ggf. auch als quasi neutrale vertrauensvolle Stelle innerhalb des Verantwortlichen agieren, ggf. die (Teil-)Auskünfte zusammenführen und diese an die betroffene Personversenden. - Ähnliche Probleme treten bei Stellungnahmen nach Art. 58 Abs. 1 lit. a DS-GVO auf, wenn sich Betriebsräte weigern, an internen Untersuchungen mitzuwirken.
Da die Durchsetzung der Unterstützungspflicht eine arbeitsrechtliche Frage ist, bedarf sie zivilrechtlicher Klärung. Die Bewertung der Fälle erfolgt daher unter Berücksichtigung der vom Arbeitgeber unternommenen Maßnahmen zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben.
(Foto: magele-picture – stock.adobe.com)
Letztes Update:30.03.25
Verwandte Produkte
Das könnte Sie auch interessieren
-

Folge 83: Psychologie im Spiegel der KI
Die Haltung der Menschen zu KI wandelt sich nach dem Befund des Psychologen Stephan Grünewald. Aus dem Zauberstab des „Allmachts-Boosters“ sei eine Bedrohung geworden. KI sei zwischen „persönlichem Heinzelmann und gefügigem Traumpartner“ gestartet: „Was kann ich noch selbst? Und wer bin ich überhaupt noch?“. Diese Fragen stellen sich für den Menschen. Wie hätte man vor
Mehr erfahren -

Folge 86: KI-Daten-Wirtschaft – Der Parlamentarische Abend der GDD im Rückblick
Im Dezember 2025 hat die GDD zum Parlamentarischen Abend in der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft in Berlin eingeladen. Unter der Schirmherrschaft von MdB Günter Krings haben Thomas Jarzombek, Parlamentarischer Staatssekretär im BMDS, Dr. Daniela Brönstrup, Vizepräsidentin der BNetzA, und DSK-Chef Tobias Keber, VAUNET-Chef Claus Grewenig, der Neuropathologe Felix Sahm und Kristin Benedikt diskutiert, moderiert von Rolf
Mehr erfahren -

EuGH: Banken haften auch ohne Verurteilung ihrer Organmitglieder
Der Europäische Gerichtshof hat mit Urteil vom 29. Januar 2026 (C-291/24) entschieden, dass die EU-Geldwäscherichtlinie einer nationalen Regelung entgegensteht, die Sanktionen gegen juristische Personen von der förmlichen Feststellung der Schuld natürlicher Personen abhängig macht. Das Urteil stärkt die Durchsetzbarkeit von Compliance-Anforderungen im Finanzsektor. Ausgangssachverhalt aus Österreich Die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) hatte gegen die Steiermärkische Bank
Mehr erfahren