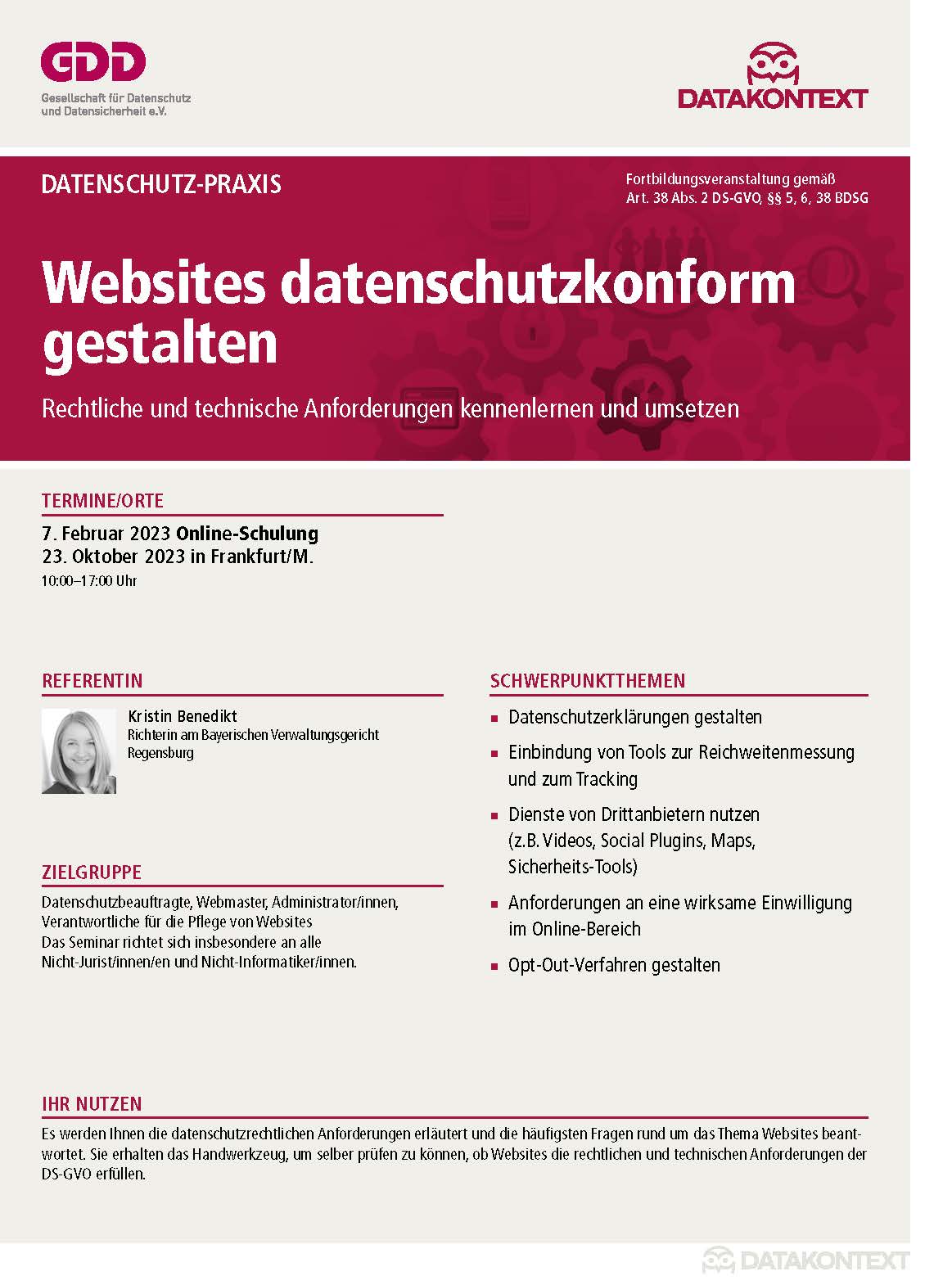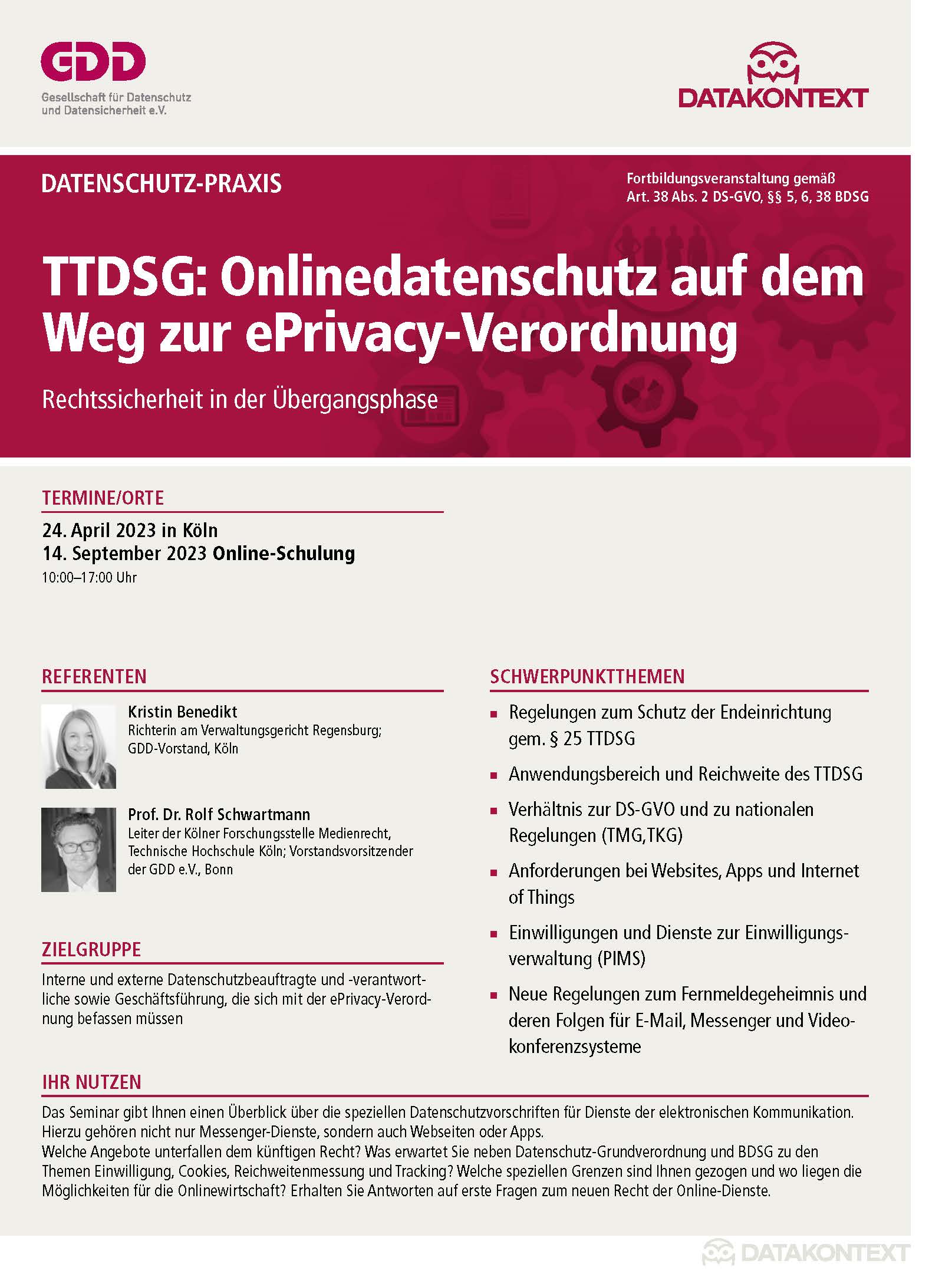Wettbewerbsrechtliche Prüfung kann sich auch auf Datenschutz erstrecken

Der Europäische Gerichtshof hat im Rahmen einer kartellrechtlichen Abwägungsentscheidung festgestellt, dass das Bundeskartellamt auch datenschutzrechtliche Vorschriften berücksichtigen darf. Dieses Urteil resultiert aus einem Verfahren, das auf die Entscheidung des Bundeskartellamts in Bezug auf Meta (ehemals Facebook) im Jahr 2019 zurückgeht. Das Bundeskartellamt hatte Meta per Verfügung untersagt, Daten aus verschiedenen Quellen wie Instagram, WhatsApp und Co ohne Einwilligung der Nutzer zusammenzuführen.
Meta legte gegen diese Entscheidung beim Oberlandesgericht Düsseldorf Beschwerde ein. Das Gericht stellte dem Europäischen Gerichtshof mehrere Fragen, um zu klären, wie bestimmte Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) auszulegen sind und ob das Bundeskartellamt bei kartellrechtlichen Abwägungsentscheidungen auch Normen der DS-GVO berücksichtigen darf. Insbesondere betrachtet das Gericht die Sammlung von Informationen, die Aufschluss über politische Meinungen, religiöse Zugehörigkeit oder sexuelle Orientierung einer Person geben, als problematisch.
Der EuGH betonmte jedoch, dass die nationale Wettbewerbsbehörde im Falle der Festellung eines Veerstoßes gegen die DS-GVO nicht an die Stelle der durch diese Verordnung eingerichteten Aufsichtsbehörden tritt. Die Prüfung, ob die DS-GVO eingehalten wird, erfolge nämlich ausschließlich, um den Missbrauch einer beherrschenden Stellung festzustellen und gemäß den wettbewerbsrechtlichen Vorschriften Maßnahmen zur Abstellung dieses Missbrauchs aufzuerlegen.
Auch zu der Frage der Zulässigkeit der Verarbeitung besonderer Arten personenbezogener Daten gem. Art. 9 Ds-GVO traf der EuGH eine beachtenswerte Bewertung.
Aus dem Umstand, dass die betroffene Person diese Daten offensichtlich öffentlich gemacht hat oder die bloße Tatsache, dass ein Nutzer Websites oder Apps aufruft, die solche Informationen offenbaren können, kann nach Auffassung des EuGH nicht sicher geschlossen werden, dass er seine Daten im Sinne der DS-GVO offensichtlich öffentlich macht. Ebenso verhalte es sich, wenn ein Nutzer Daten auf solchen Websites oder in solchen Apps eingebe oder darin eingebundene Schaltflächen betätige, es sei denn, er habe zuvor explizit seine Entscheidung zum Ausdruck gebracht, die ihn betreffenden Daten einer unbegrenzten Zahl von Personen öffentlich zugänglich zu machen.
Gerichtshof der Europäischen Union
Letztes Update:05.07.23
Verwandte Produkte
-
Social Media – Was gibt es in der Praxis alles zu beachten?
Online-Kompaktkurs
153,51 € Mehr erfahren
Das könnte Sie auch interessieren
-

LinkedIn-Verrnetzung begründet keine Einwilligung für Werbe‑E‑Mails
Das AG Düsseldorf hat mit Urteil vom 20.11.2025 (Az. 23 C 120/25) klargestellt, dass berufliche Vernetzung in sozialen Netzwerken keine Einwilligung für den Versand werblicher E-Mails begründet. Hintergrund war ein Fall, in dem ein IT-Dienstleister zwei Werbe-E-Mails an eine GmbH sandte, die lediglich über LinkedIn vernetzt war, ohne dass eine ausdrückliche Zustimmung vorlag. LinkedIn-Kontakte ≠ Einwilligung für
Mehr erfahren -

Vergütung für nicht deklariertes „KI-Gutachten“ kann verweigert werden
Das Landgericht Darmstadt hat in einem Beschluss vom November 2025 (19 O 527/16) klargestellt, dass eine erhebliche, nicht gegenüber dem Gericht offengelegte Verwendung von Künstlicher Intelligenz (KI) bei der Erstellung eines gerichtlichen Sachverständigengutachtens zur vollständigen Versagung der Vergütung führen kann. Damit stärkt das Gericht die Anforderungen an Transparenz, persönliche Leistungspflicht und Nachvollziehbarkeit bei Gutachten, die im Rahmen zivilprozessualer
Mehr erfahren -
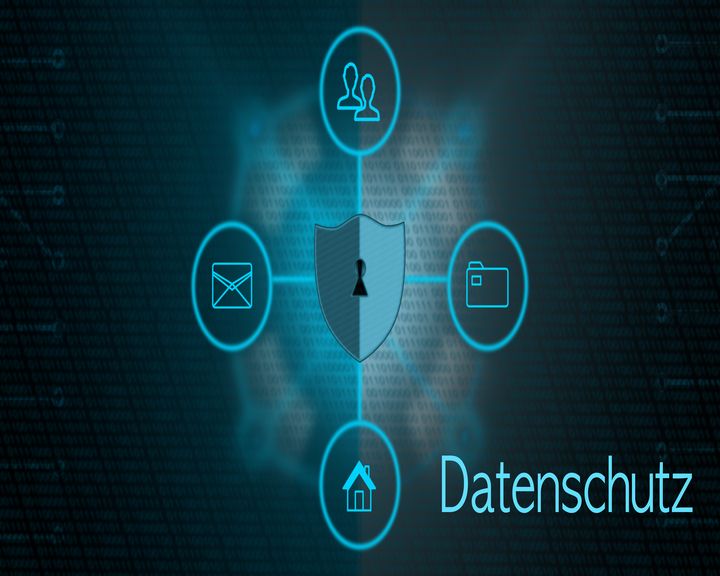
Gemeinsame Dateiablagen als datenschutzrechtliches Risiko
In der Aktuellen Kurz-Information 65 weist der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz auf die erhebliche Gefahr von Datenpannen durch gemeinsam genutzte Dateiablagen hin. Betroffen sind sowohl klassische Netzlaufwerke als auch moderne Kollaborationsplattformen wie Microsoft SharePoint. Diese Systeme dienen zwar der effizienten Zusammenarbeit, können jedoch bei unzureichender Konfiguration und Organisation zu unbeabsichtigten Offenlegungen personenbezogener Daten führen.
Mehr erfahren