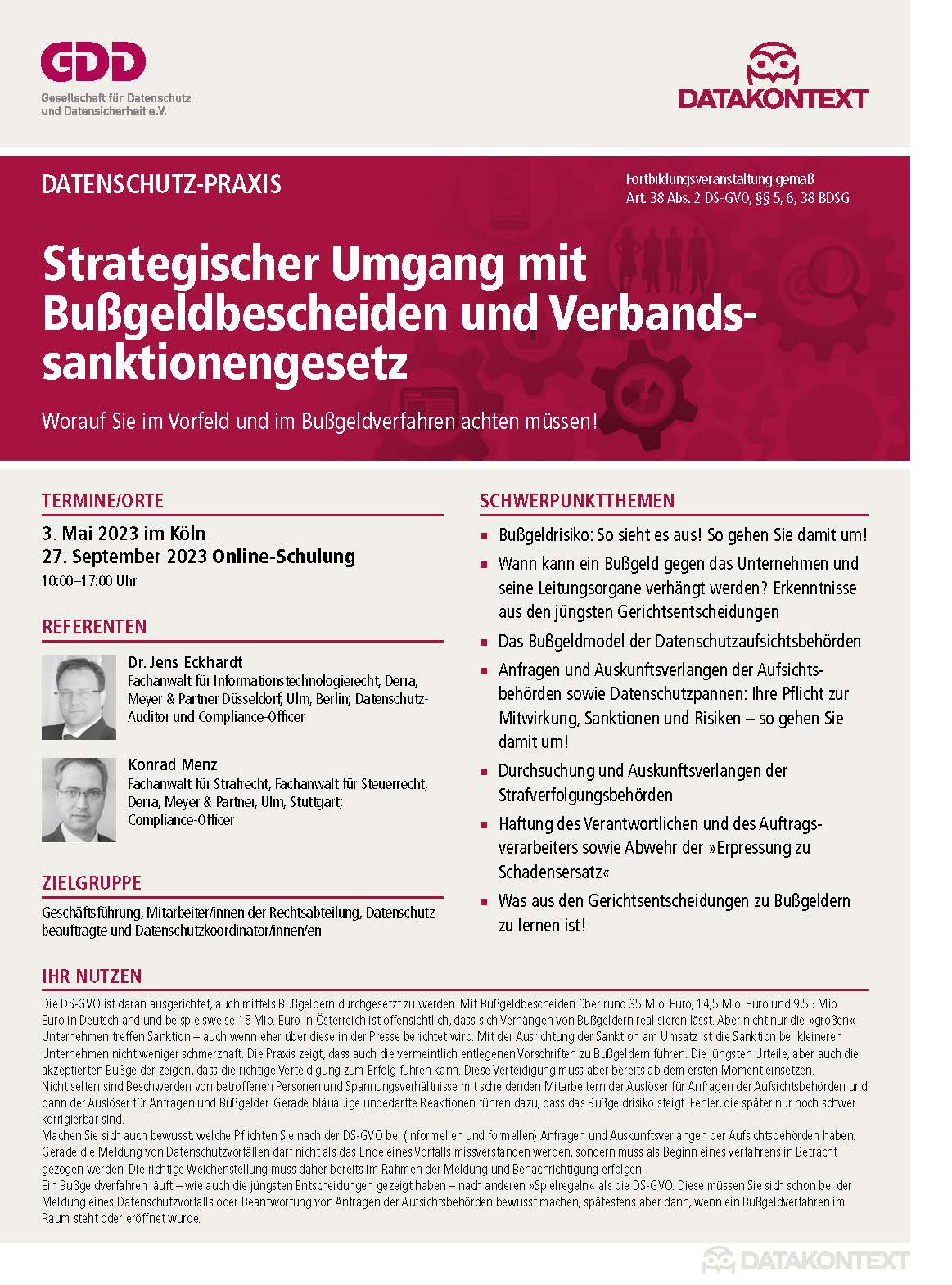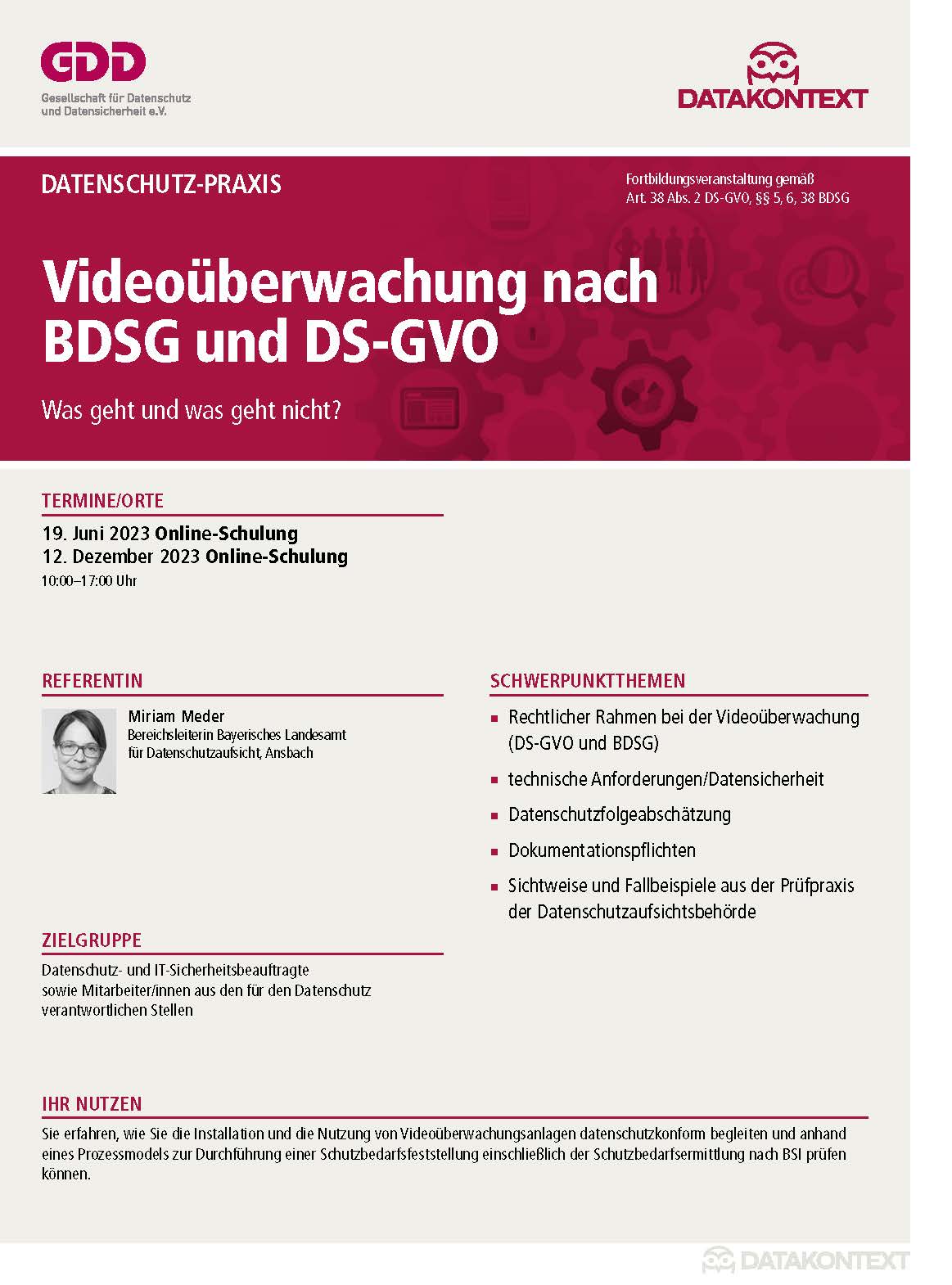DS-GVO gilt nicht für abgeschaltete Überwachungskameras

Die DS-GVO findet gem. Art. 1 Abs. 1 DS-GVO nur dann Anwendung, wenn auch tatsächlich personenbezogene Daten verarbeitet werden. Zu beachten ist, dass durch sogenannte Kamera-Dummys der Eindruck einer Überwachung und Datenverarbeitung entsteht, sodass auch Videokameras ohne tatsächliche Funktion das Persönlichkeitsrecht betroffener Personen beeinträchtigen können. Eine Datenverarbeitung findet aber nicht statt. Daher können die Vorschriften der DS-GVO und des BDSG keine Anwendung finden (Vgl. ULD, Praxisreihe Datenschutzbestimmungen praxisgerecht umsetzen, Ziffer 8).
Zweck einer Kamera-Attrappe ist es, das Verhalten von Menschen in eine gewünschte Richtung zu lenken. Obwohl tatsächlich niemand gefilmt wird, erzeugen täuschend echte Kameragehäuse einen sogenannten Überwachungsdruck. Müssen Dritte eine Überwachung objektiv ernsthaft befürchten, kann der erzeugte Verhaltensdruck für eine Verletzung der Persönlichkeitsrechte ausreichen. Wer eine Attrappe zur Verhaltenssteuerung Dritter einsetzt, muss damit rechnen, dass zivilrechtliche Abwehransprüche (bspw. auf Unterlassen oder Schadensersatz) gegen ihn oder sie geltend gemacht werden (vgl. DSK, Orientierungshilfe Videoüberwachung durch nicht-öffentliche Stellen, Ziffer 1.3). Diese können dann gegen den Betreiber geltend machen wegen Verletzungen des Persönlichkeitsrechts gem. Art. 2 Abs. 1 GG i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG ( so z.B. das Landgericht Essen, Urteil v. 30.01.2019, Az. 12 O 62/18).
Die Frage ist, ob sich diese Bewertung ändert, wenn es sich nicht um Kamera-Attrappen handelt, sondern um abgeschaltete Überwachungskameras. Mit einem solchen Fall hat sich das OVG Rheinland-Pfalz (Urteil vom 25.06.2021 10 A 10302/21) beschäftigt:
Der für die Verarbeitung Verantwortliche errichtete eine LED-Werbetafel auf einem Privatparkplatz. Da es dort in der Vergangenheit regelmäßig zu Vandalismus gekommen war, stellte der für die Verarbeitung Verantwortliche verschiedene Kameras auf, die rund um die Uhr in Betrieb waren und teilweise den öffentlichen Verkehrsraum aufzeichneten. Die Datenschutzbehörde ordnete unter anderem an, dass die Datenverarbeitung durch eine der Kameras gestoppt und diese Kamera abgebaut werden sollte.
Der für die Verarbeitung Verantwortliche legte gegen diese Anordnung Widerspruch ein. Das erstinstanzliche Gericht (VG Mainz – 1 K 584/19.MZ) entschied, dass die Einstellungsverfügung rechtmäßig, die Abbauverfügung jedoch rechtswidrig sei. Die Behörde akzeptierte diese Entscheidung und war insbesondere damit einverstanden, dass er die Kamera nicht mehr einschalten durfte.
Dagegen legte der Beklagte Berufung gegen die Aufhebung der Abbauverfügung ein. Die Berufung blieb erfolglos.
Das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (OVG Rheinland-Pfalz) entschied, dass zum einen der Anwendungsbereich der DS-GVO für die ausgeschaltete Kamera nicht eröffnet sei. Zum anderen ermächtige Artikel 58 Absatz 2 lit. f) DS-GVO nicht zur Anordnung des Abbaus einer (stillgelegten) Kamera.
Nach Ansicht des Gerichts ist der Anwendungsbereich der DS-GVO nicht eröffnet. Es finde keine Verarbeitung im Sinne von Artikel 4 Absatz 2 DS-GVO statt. Videoaufzeichnungen und ihre vorübergehende Speicherung seien unbestreitbar eine Datenverarbeitung, aber eine deaktivierte Kamera verarbeitee keine Daten (mehr). In der nächsten Instanz erhob der Betreiber der LED-Tafel keine Einwände mehr gegen die Unterlassungsverfügung. Die Anordnung ist unanfechtbar geworden. Da es keine Anhaltspunkte für einen anordnungswidrigen Weiterbetrieb gab, war nach Ansicht des Gerichts davon auszugehen, dass die Kamera ausgeschaltet war und blieb.
(Foto: denisismagilov – stock.adobe.com)
Letztes Update:08.08.21
Verwandte Produkte
-
Strategischer Umgang mit Bußgeldbescheiden und Verbandssanktionengesetz
Seminar
696,15 € Mehr erfahren
Das könnte Sie auch interessieren
-

Folge 82: „Leben mit KI ist … eine große Chance“
Roland Koch Professor an der Frankfurt School of Finance and Management und kennt sich aus in Fragen der Regulierung und der Digitalisierung. Er war von 1999 bis 2010 Hessischer Ministerpräsident. Im DataAgenda Podcast zum Jahresabschluss 2025 spricht er über seine Haltung zu KI, den betrieblichen Datenschutz, den Jugendschutz in Sozialen Netzwerken und über das Verhältnis
Mehr erfahren -

Datenschutz in der medizinischen Forschung
Ddie Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM) und der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (HBDI) haben im Dezember 2025 einen gemeinsam erarbeiteten Leitfaden zur datenschutzkonformen Nutzung von Gesundheitsdaten in der medizinischen Forschung vorgelegt. Ziel ist es, Forschenden eine praxisnahe und rechtssichere Anleitung zu bieten, damit Studien mit sensiblen Patientendaten im Einklang mit der Datenschutz‑Grundverordnung
Mehr erfahren -

Leitfaden für „moderne verteidigungsfähige IT-Architektur“
Das BSI hat Anfang November 2025 einen neuen Leitfaden veröffentlicht, der unter dem Begriff Modern Defensible Architecture (MDA) firmiert. Ziel ist es, Organisationen (öffentliche wie private) eine praxisnahe Orientierung für den Aufbau und Betrieb sicherer, resilienter IT‑Architekturen zu geben. Warum MDA wichtig ist In Zeiten zunehmender Cyberbedrohungen und wachsender Komplexität digitaler Infrastrukturen reichen traditionelle Sicherheitskonzepte
Mehr erfahren