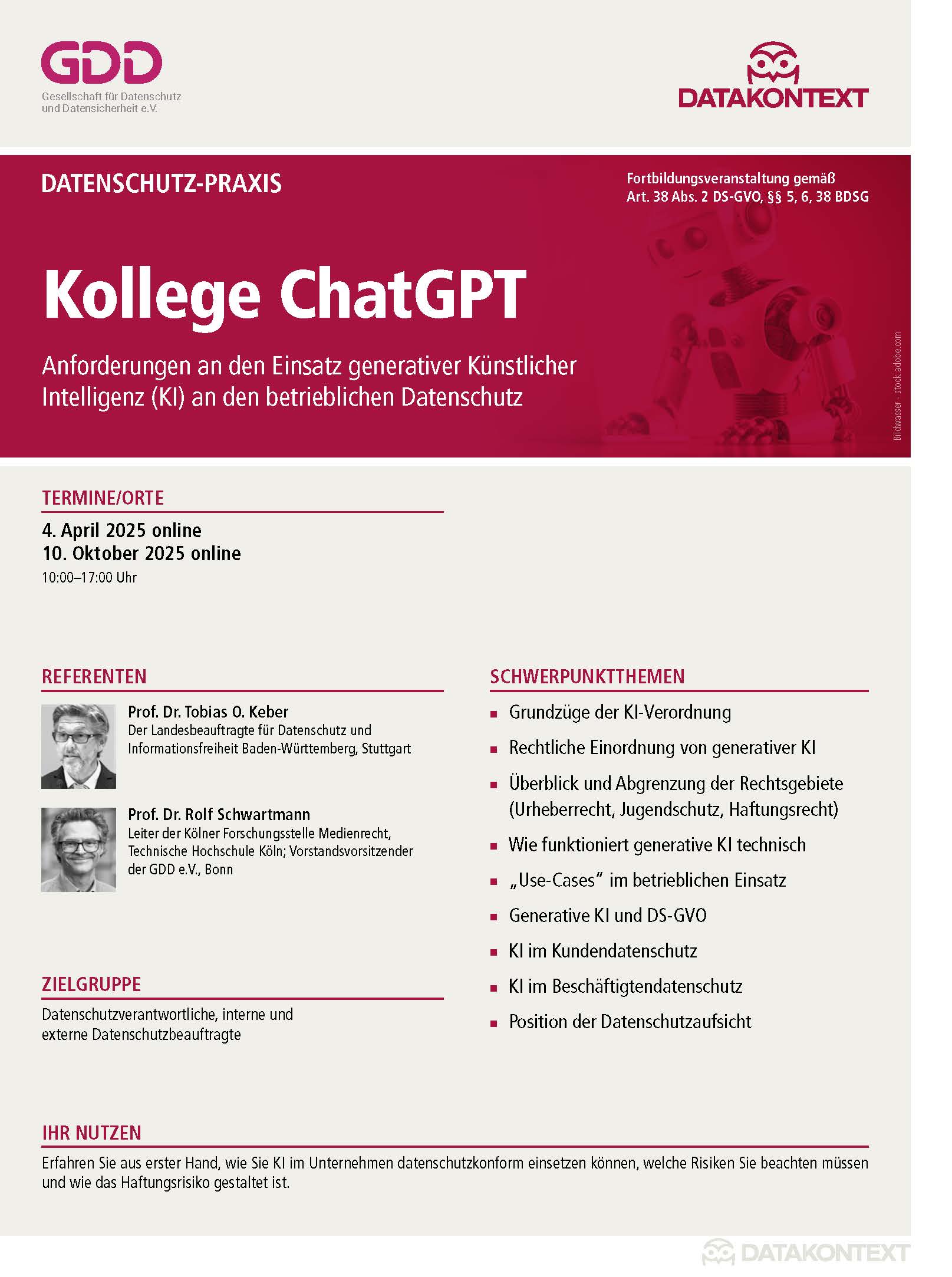KI in der Anwaltskanzlei: Chancen verantwortungsvoll nutzen

KI-Anwendungen bieten vielfältige Möglichkeiten für den Einsatz in Anwaltskanzleien, bringen jedoch auch berufsrechtliche Herausforderungen mit sich. Insbesondere „große“ Sprachmodelle wie ChatGPT, bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten – von Recherche- und Analyse-Tools bis hin zur automatisierten Übersetzung von Rechtsdokumenten. Ein neuer Leitfaden der Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) unterstützt Anwältinnen und Anwälte dabei, KI-Tools rechtssicher und berufsrechtskonform zu nutzen
Sprachmodelle generieren Texte auf Basis statistischer Wahrscheinlichkeiten, ohne den Inhalt tatsächlich zu „verstehen“. Dies könne zu sogenannten „Halluzinationen“ führen – der Erzeugung faktisch falscher, aber plausibel erscheinender Inhalte. In der rechtlichen Beratung können solche Fehler gravierende Konsequenzen haben, z. B. durch unrichtige Angaben in Schriftsätzen.
Zusätzlich bestehe die Gefahr von Verzerrungen (Bias) durch einseitiges oder unzureichendes Trainingsmaterial. Trotz erheblicher Verbesserungen seit der Einführung von ChatGPT im November 2022 bleiben diese Herausforderungen bestehen.
Für Kanzleien sei es daher essenziell, KI-Ergebnisse sorgfältig zu prüfen und stets berufsrechtskonform einzusetzen, um haftungsrechtliche Risiken zu minimieren und von den Vorteilen der Technologie zu profitieren.
Insbesondere die Beachtung der anwaltlichen Verschwiegenheit nach § 43a Abs. 2 BRAO muss auch beim Einsatz von KI und LLMs unbedingt sichergestellt sein. Dieses Gebot erstreckt sich auf alle Informationen, die der Rechtsanwältin bzw. dem Rechtsanwalt in Ausübung des Anwaltsberufes im Rahmen eines Mandats bekannt werden (§ 43aAbs. 2 Satz 2 BRAO). Die unbefugte Offenbarung eines der Rechtsanwältin bzw. dem Rechtsanwalt anvertrauten fremden Geheimnisses ist strafrechtlich abgesichert nach § 203 Abs. 1 Nr. 3 StGB.
Der Leitfaden bietet Anwältinnen und Anwälten Orientierung zu zentralen Themen wie Prüfungs- und Kontrollpflichten, der Wahrung der anwaltlichen Verschwiegenheitspflicht sowie Transparenzpflichten beim Einsatz von KI. Darüber hinaus werden die wesentlichen Anforderungen der KI-Verordnung und deren Verhältnis zum Berufsrecht erläutert. Ergänzend enthält der Leitfaden Hinweise zu weiteren Risiken und verweist auf Leitfäden europäischer Anwaltsorganisationen und der Datenschutzkonferenz.
Die Hinweise der BRAK können durchaus als Grundlage für die Erstellung einer knapperen Kanzlei-Policy genutzt werden.
(Foto: Ei – stock.adobe.com)
Letztes Update:12.01.25
Verwandte Produkte
Das könnte Sie auch interessieren
-

Gutachten: Datenschutz‑Defizite bei PayPal
Ein aktuelles Gutachten des Netzwerks Datenschutzexpertise kritisiert die DS-GVO‑Praxis von PayPal. Demnach erhebt und verarbeitet der Zahlungsdienstleister weit über die reine Zahlungsabwicklung hinausgehende Daten – darunter Transaktions-, Identifikations-, Geräte- und abgeleitete Profildaten – auch für Werbe- und Marketingzwecke. Sensible Daten werden teilweise ohne hinreichende Schutzmaßnahmen verarbeitet. Zentrale Schwachstellen betreffen Transparenz und Einwilligung: Nutzer werden unzureichend
Mehr erfahren -

BSI‑Analyse: Sicherheitslage bei Passwortmanagern
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat im Rahmen einer IT‑Sicherheitsanalyse auf dem digitalen Verbrauchermarkt die Sicherheitsaspekte gängiger Passwortmanager untersucht. Der Bericht basiert auf einer Bewertung von zehn verbreiteten Produkten verschiedener Typen (inkl. browserbasierter Lösungen, Apps und Open‑Source‑Varianten). Ziel ist es, Chancen und Risiken dieser zentralen Tools zur Passwortverwaltung praxisnah aufzuzeigen. Wesentliche Befunde
Mehr erfahren -

BSI-Bewertung zur Sicherheit von E-Mail-Programmen
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat jüngst im Rahmen seines Digitalen Verbraucherschutz-Berichts (DVS) eine Untersuchung zur Sicherheit gängiger E-Mail-Programme veröffentlicht. Der Report beleuchtet, inwiefern etablierte Clients und Softwarelösungen zentrale Sicherheits- und Datenschutzanforderungen erfüllen, insbesondere im Hinblick auf Verschlüsselung, Authentifizierung und Schadsoftware-Abwehr. Kernpunkte der Analyse Ergebnisse und Einordnung Die vorläufige Bewertung des BSI
Mehr erfahren