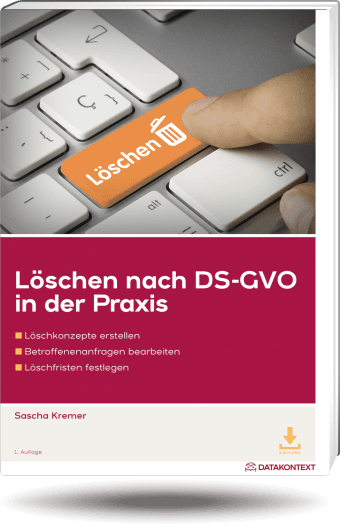Löschen nach DS-GVO leicht gemacht

Mit Mustern, Checklisten und Umsetzungshilfen zum rechtskonformen Löschen
Die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) als gesetzliche Regelung zur Verarbeitung personenbezogener Daten hat den Datenschutz nachhaltig verändert und geprägt. Dennoch hat sie nicht alles neu geregelt, sondern auch viele bewährte Prinzipien fortgeführt. Ausgehend von dem Grundsatz der Zweckbindung sind Daten zu löschen, wenn deren Speicherung und Verarbeitung nicht mehr erforderlich ist. Die daraus resultierende Löschpflicht ist also keineswegs neu. Vielmehr kommt der Umsetzung von Löschpflichten wegen der allgemein gestiegenen Anforderungen an den Datenschutz und vor allem wegen dem erhöhten Sanktionsrisiko eine besondere Bedeutung zu. Schließlich drohen mit der DS-GVO schnell Bußgelder in Höhe von bis zu 20 Millionen Euro.
Speicherplatz ist ausreichend vorhanden – Warum dann noch Löschen?
Abläufe verlagern sich ins Digitale, Prozesse werden automatisiert, die verarbeitete Datenmenge wächst permanent. Speicherplatz ist günstig bis umsonst und steht dementsprechend den Nutzern gefühlt unbegrenzt zur Verfügung. Demzufolge besteht jedenfalls keine intrinsische Motivation mehr bei den Nutzern den Server oder das E-Mail-Postfach „ordentlich“ zu halten. Der sog. data-life-cycle eines personenbezogenen Datums (von der Erhebung über die Verarbeitung bis zur Löschung) findet somit kein Ende mehr, was auch insgesamt zu einer völlig unübersichtlichen Datenstruktur führt und daher nicht unterschätzt werden sollte.
Löschen ist Pflicht – Aufbewahren aber auch
Aufgrund des Prinzips der Datenminimierung (Art. 5 Abs. 1 lit. c DS-GVO) und dem Grundsatz der Zweckbindung, besteht nach Wegfall der Erforderlichkeit kein Rechtsgrund mehr zur weiteren Speicherung. Gleichwohl gibt es regelmäßig gesetzliche Aufbewahrungspflichten, die einem Löschen zu diesem Zeitpunkt zuwiderlaufen. Eine Löschung ist sogar dann unzulässig, wenn der Löschung gesetzliche, satzungsmäßige oder vertragliche Aufbewahrungsfristen entgegenstehen oder wenn Grund zu der Annahme besteht, dass durch eine Löschung schutzwürdige Interessen der Betroffenen beeinträchtigt würden.
Datenschutzkonforme Umsetzung der Löschpflicht in der Praxis
Weil es einerseits allgemeine Löschpflichten gibt, andererseits aber dem entgegenstehende gesetzliche Aufbewahrungspflichten (z.B. HGB, AO u.a.) und für viele Datenarten gar keine Regelung existiert, ist der Umgang mit gespeicherten Daten eine immense Herausforderung. Zwischen Lösch- und Aufbewahrungspflichten, Löschrechten, -methoden und -alternativen ist es schwierig, den Überblick zu bewahren. Unternehmen und übrige Verantwortliche stehen hierbei vor den Herausforderungen, aus Regelungen Anforderungen für das eigene Unternehmen abzuleiten und mit ihnen ein rechtskonformes Löschkonzept zu erstellen.
Das neue Buch „Löschen nach DS-GVO in der Praxis“ leistet konkrete Praxishilfe
DATAKONTEXT bietet nun mit dem Buch „Löschen nach DS-GVO in der Praxis“ bei einem schwierigen Thema für die Praxis Unterstützung. Der Autor Sascha Kremer ist Gründer und Fachanwalt für IT-Recht bei KREMER RECHTSANWÄLTE in Köln sowie externer Datenschutzbeauftragter. Auf 128 Seiten erklärt er, welche Prozesse beim Verantwortlichen für das rechtskonforme Löschen implementiert sein müssen. Dabei wird der Weg für das Ermitteln von Speicherdauer und Löschfristen aufgezeigt, Löschmethoden erläutert und im Ergebnis die praktische Umsetzung des Löschens dargelegt. Zusätzlich gibt es als Umsetzungshilfe zum Download eine Checkliste sowie eine Musterlösung für ein ausführliches Löschkonzept des Verantwortlichen. Damit erhält der Leser anwendungsorientiert und unterstützend Werkzeuge und Hilfestellungen bei der Erstellung eines eigenen rechtskonformen Löschkonzepts. Mehr Informationen zu dem Buch finden Sie unter www.datakontext.com/loeschkonzepte
.
(Bild: stock.adobe.com/andranik123)
Letztes Update:03.11.20
Verwandte Produkte
Das könnte Sie auch interessieren
-

Elektronische Patientenakte: Datenschutzrisiken und Drittstaatenzugriffe
Die Einführung der elektronischen Patientenakte (ePA) in Deutschland wirft weiterhin grundlegende datenschutzrechtliche Fragen auf. Eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (Drucksache 21/1912) fokussiert unter anderem auf die Möglichkeit, dass Dienstleister wie IBM Deutschland GmbH oder RISE GmbH Daten der ePA aufgrund außereuropäischer Gesetze an Behörden außerhalb der EU übermitteln könnten. Technische und organisatorische Schutzmaßnahmen Die
Mehr erfahren -

BVwG (Österreich) konkretisiert Haushaltsausnahme nach DS-GVO
Im zugrunde liegenden Verfahren (W258 2242162-1/24E) beschwerte sich eine Nachbarin über heimliche Bildaufnahmen, die ein Anrainer in ihrer privaten Garagenbox angefertigt und anschließend an ihren früheren Lebensgefährten weitergegeben haben soll. Die Datenschutzbehörde (DSB) stellte 2021 eine Verletzung des Rechts auf Geheimhaltung gemäß § 1 Abs. 1 DSG fest. Gegen diesen Bescheid erhob der Beschwerdegegner Rechtsmittel.
Mehr erfahren -

BEM: Weitergabe betriebsärztlicher Gutachten an die Schwerbehindertenvertretung
In einem vom BEM zu unterscheidenden Präventionsverfahren nach § 167 Abs. 1 SGB IX schaltet der Arbeitgeber frühzeitig unter anderem die Schwerbehindertenvertretung ein, wenn personen-, verhaltens- oder betriebsbedingte Schwierigkeiten eintreten, die das Beschäftigungsverhältnis mit einem schwerbehinderten oder ihm gleichgestellten Menschen gefährden könnten. Ziel dieses Verfahrens ist es, eine vorzeitige Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses (insbesondere durch Kündigung) aufgrund dieser
Mehr erfahren