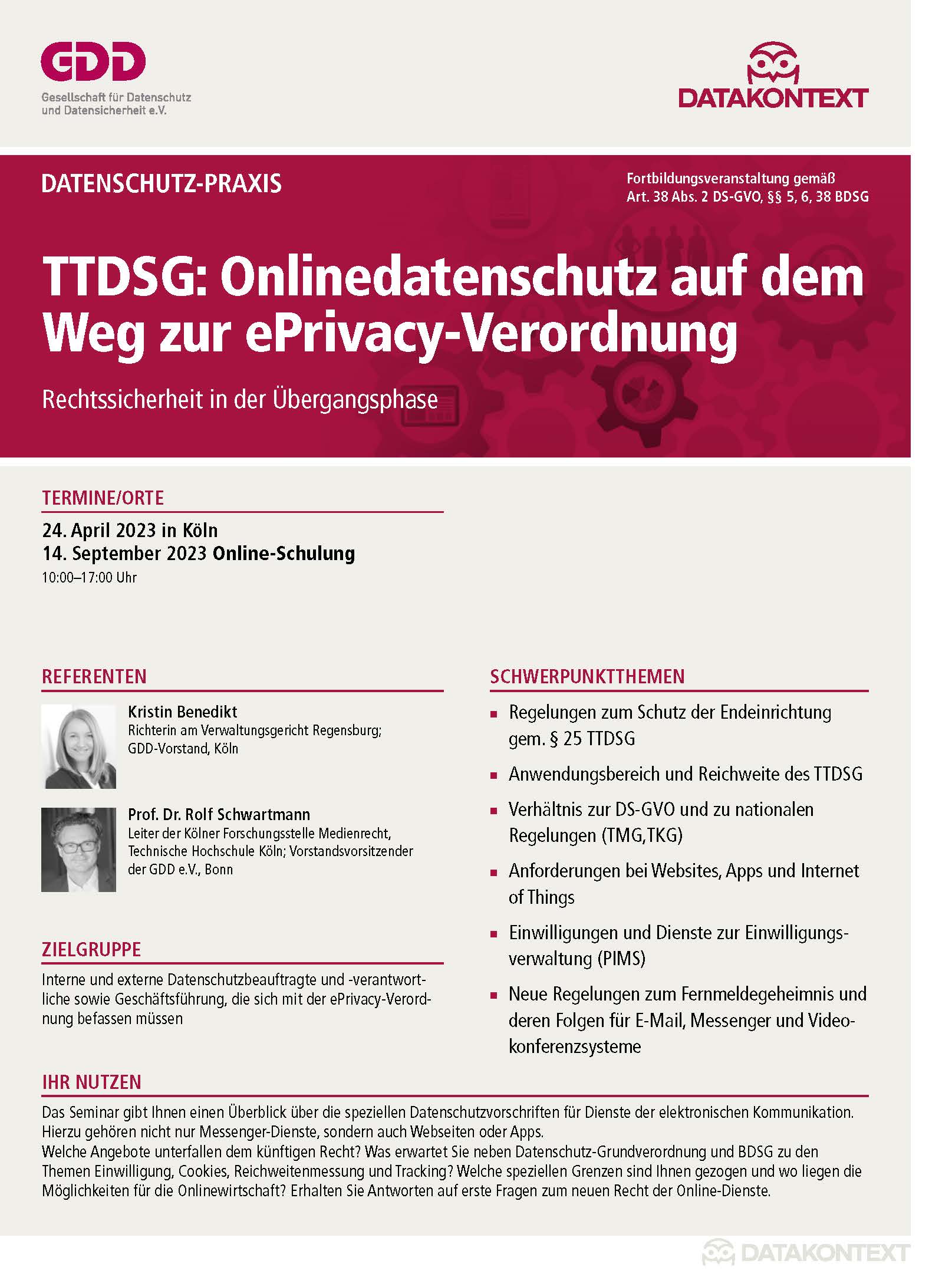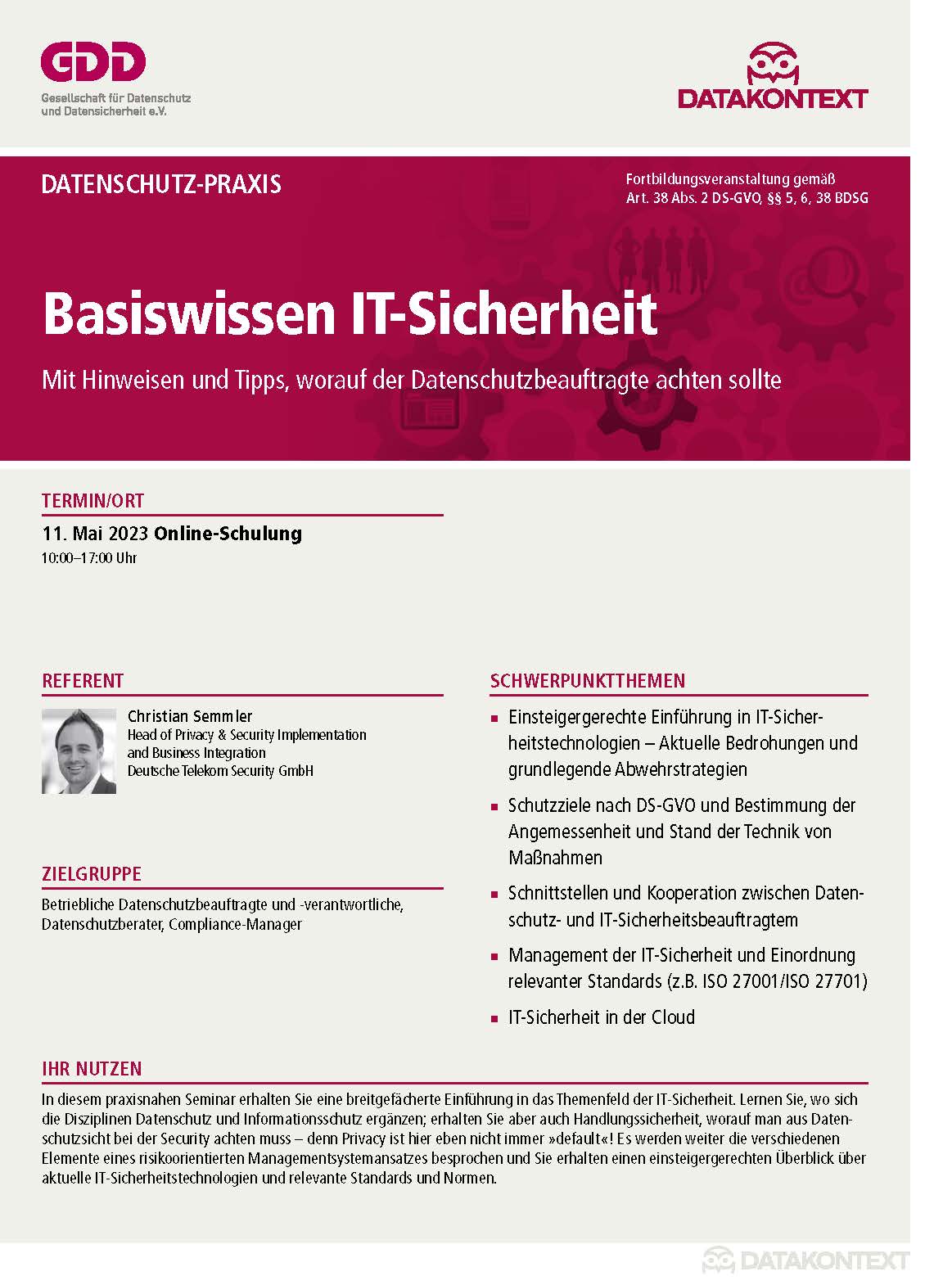Bundeskartellamt bemängelt Datenschutz-Defizite bei Apps

Die am 09. Juni 2017 in Kraft getretene 9. GWB-Novelle verschafft dem Bundeskartellamt die Befugnis, sogenannte Sektoruntersuchungen auch im Bereich des Verbraucherschutzes durchzuführen.
Das Bundeskartellamt hat in diesem Rahmen die Möglichkeit, Untersuchungen anzustellen und Problemfelder aufzuzeigen. Im Gegensatz zu seinen kartellrechtlichen Zuständigkeiten, hat das Bundeskartellamt hier jedoch nicht die Möglichkeit, etwaige Rechtsverstöße auch behördlicherseits abzustellen oder zu sanktionieren.
Das Bundeskartellamt hat Ende Juli die Ergebnisse einer verbraucherrechtlichen Untersuchung zu Mobilen Apps vorgelegt, die im Rahmen der oben geschilderten Kompetenzen erstellt wurde. Darin werden auch Problemfelder genannt, die eindeutig datenschutzrechtliche Defizite adressieren. Diese sind unter anderen:
Mangelnde Information über Datenzugriffe bei der Nutzung von Apps:
So wird bemängelt, dass bei zahlreichen Apps Nutzerinnen und Nutzer nicht angemessen darüber aufgeklärt, inwieweit Drittunternehmen wie etwa Facebook oder Google bei der Nutzung der Apps personenbezogene Daten erhalten und um welche Daten es sich überhaupt handelt. Weder die Beschreibungen von Apps in den App-Stores noch die Datenschutzerklärungen der App-Publisher geben hierüber hinreichend Aufschluss, so das Bundeskartellamt. In diesem Zusammenhang wird es als wünschenswert betrachtet, dass Nutzer über eine verbesserte Suchfunktion in App-Stores bereits gezielter nach verbraucherfreundlichen Apps (z. B. ohne Tracker oder Werbung) suchen könnten.
Mangelnde Kontrollmöglichkeiten über die Datenverarbeitung:
Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass zwar dem Wunsch der Verbraucherinnen und Verbraucher nach mehr Kontrolle über die Verarbeitung ihrer persönlichen Daten auf Ebene der Betriebssystem-Einstellungen von iOS bzw. Android ansatzweise entsprochen wird. Jedoch bleibe für manche Innovationen im Datenschutzbereich hier noch viel Raum für Verbesserungen. Klare und deutliche Informationen müssten nach Auffassung des Bundeskartellamts mit einfachen Einstellungsmöglichkeiten kombiniert werden. So sollten Verbraucherinnen und Verbraucher Datenzugriffe durch Apps effektiv abstellen und alle nicht-systemrelevanten Apps löschen können.
Zum Thema „Datenschutzanforderungen an App-Entwickler und App-Anbieter“ gibt es zwar eine Orientierungshilfe der Datenschutz-Aufsichtsbehörde. Diese ist jedoch noch aus der Feder des sog. Düsseldorfer Kreises (des Vorgängers der Datenschutzkonferenz (DSK), dem Gremium der unabhängigen deutschen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder). Die Orientierungshilfe stammt aus dem Jahre 2014 und damit noch vor Wirksamkeit der DS-GVO.
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat zwar eine Technische Richtlinie (TR) entwickelt, die sich ebenfalls mit Apps beschäftigt. Dabei liegt der Fokus aber zum einen naturgemäß auf den Schutzzielen der IT-Sicherheit: Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit. Zum anderen betrachtet die TR speziell sog. Gesundheitsapps.
(Foto: MclittleStock- stock.adobe.com)
Letztes Update:03.08.21
Verwandte Produkte
Das könnte Sie auch interessieren
-

Elektronische Patientenakte: Datenschutzrisiken und Drittstaatenzugriffe
Die Einführung der elektronischen Patientenakte (ePA) in Deutschland wirft weiterhin grundlegende datenschutzrechtliche Fragen auf. Eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (Drucksache 21/1912) fokussiert unter anderem auf die Möglichkeit, dass Dienstleister wie IBM Deutschland GmbH oder RISE GmbH Daten der ePA aufgrund außereuropäischer Gesetze an Behörden außerhalb der EU übermitteln könnten. Technische und organisatorische Schutzmaßnahmen Die
Mehr erfahren -

BVwG (Österreich) konkretisiert Haushaltsausnahme nach DS-GVO
Im zugrunde liegenden Verfahren (W258 2242162-1/24E) beschwerte sich eine Nachbarin über heimliche Bildaufnahmen, die ein Anrainer in ihrer privaten Garagenbox angefertigt und anschließend an ihren früheren Lebensgefährten weitergegeben haben soll. Die Datenschutzbehörde (DSB) stellte 2021 eine Verletzung des Rechts auf Geheimhaltung gemäß § 1 Abs. 1 DSG fest. Gegen diesen Bescheid erhob der Beschwerdegegner Rechtsmittel.
Mehr erfahren -

BEM: Weitergabe betriebsärztlicher Gutachten an die Schwerbehindertenvertretung
In einem vom BEM zu unterscheidenden Präventionsverfahren nach § 167 Abs. 1 SGB IX schaltet der Arbeitgeber frühzeitig unter anderem die Schwerbehindertenvertretung ein, wenn personen-, verhaltens- oder betriebsbedingte Schwierigkeiten eintreten, die das Beschäftigungsverhältnis mit einem schwerbehinderten oder ihm gleichgestellten Menschen gefährden könnten. Ziel dieses Verfahrens ist es, eine vorzeitige Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses (insbesondere durch Kündigung) aufgrund dieser
Mehr erfahren