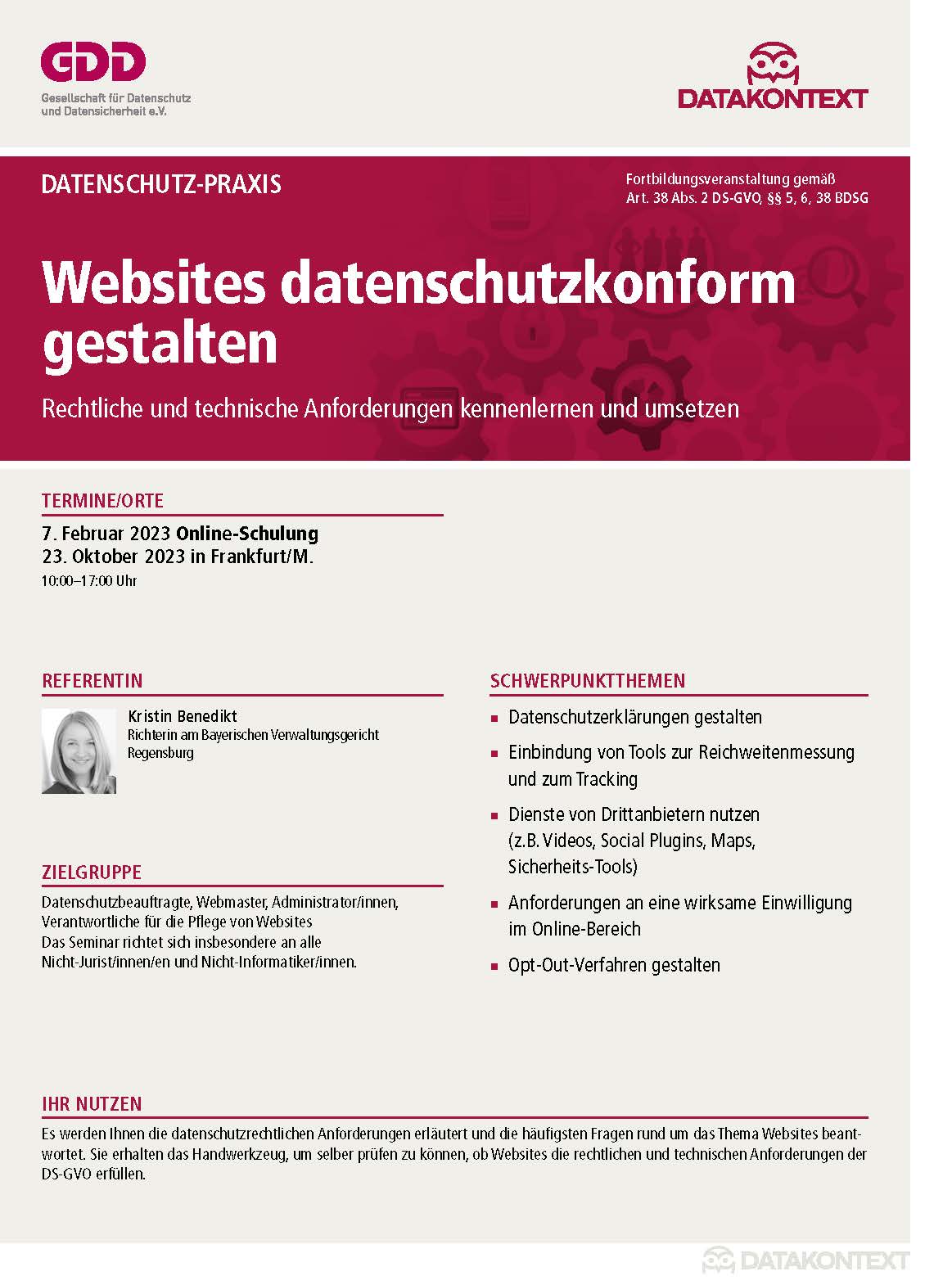Studie zum Datenschutz-Einwilligungsmanagement
Art. 4 Nr. 11 DS-GVO definiert die Einwilligung als „jede freiwillig für den bestimmten Fall, in informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist.“ Die Einwilligung ist daher einerseits Betroffenenrecht, da sie der betroffenen Person die Möglichkeit gibt, aktiv über die Verarbeitung, ihre Zwecke und näheren Umstände zu bestimmen. Andererseits ist sie aus Sicht des Verantwortlichen ein vollgültiger Erlaubnistatbestand im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO. Mittels einer Einwilligung können ggf. Verarbeitungen gerechtfertigt werden, die allein auf Grundlage der gesetzlichen Tatbestände ausgeschlossen wären.
Gemäß den Vorgaben der DS-GVO muss eine Einwilligung informiert, differenziert und freiwillig erfolgen. Um diese Anforderungen sowohl rechtssicher als auch nutzerfreundlich umzusetzen, sind Einwilligungsmanagement-Systeme (EMS) nötig.
Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hat das Forschungsprojekt „Innovatives Datenschutz-Einwilligungsmanagement“ mit dem Ziel in Auftrag gegeben, bestehende Einwilligungsmanagement-Modelle zu analysieren, Nutzerpräferenzen zu erfassen und neue Lösungsansätze zur rechtskonformen und nutzerfreundlichen Datenschutz-Einwilligung zu entwickeln. Das zentrale Ergebnis der Studie ist, dass es Möglichkeiten gibt, die Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung sowohl rechtskonform als auch nutzerfreundlich in der Praxis umzusetzen. Dazu wird für den Online-Bereich ein innovatives Best Practice-Modell mit einem konkreten Web-Design vorgestellt. Der Projektbericht beschreibt sowohl die zentralen Anforderungen an das Best Practice-Modell als auch Schritte zur Umsetzung.
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
Letztes Update:10.09.20
Verwandte Produkte
Das könnte Sie auch interessieren
-

Elektronische Patientenakte: Datenschutzrisiken und Drittstaatenzugriffe
Die Einführung der elektronischen Patientenakte (ePA) in Deutschland wirft weiterhin grundlegende datenschutzrechtliche Fragen auf. Eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (Drucksache 21/1912) fokussiert unter anderem auf die Möglichkeit, dass Dienstleister wie IBM Deutschland GmbH oder RISE GmbH Daten der ePA aufgrund außereuropäischer Gesetze an Behörden außerhalb der EU übermitteln könnten. Technische und organisatorische Schutzmaßnahmen Die
Mehr erfahren -

BVwG (Österreich) konkretisiert Haushaltsausnahme nach DS-GVO
Im zugrunde liegenden Verfahren (W258 2242162-1/24E) beschwerte sich eine Nachbarin über heimliche Bildaufnahmen, die ein Anrainer in ihrer privaten Garagenbox angefertigt und anschließend an ihren früheren Lebensgefährten weitergegeben haben soll. Die Datenschutzbehörde (DSB) stellte 2021 eine Verletzung des Rechts auf Geheimhaltung gemäß § 1 Abs. 1 DSG fest. Gegen diesen Bescheid erhob der Beschwerdegegner Rechtsmittel.
Mehr erfahren -

BEM: Weitergabe betriebsärztlicher Gutachten an die Schwerbehindertenvertretung
In einem vom BEM zu unterscheidenden Präventionsverfahren nach § 167 Abs. 1 SGB IX schaltet der Arbeitgeber frühzeitig unter anderem die Schwerbehindertenvertretung ein, wenn personen-, verhaltens- oder betriebsbedingte Schwierigkeiten eintreten, die das Beschäftigungsverhältnis mit einem schwerbehinderten oder ihm gleichgestellten Menschen gefährden könnten. Ziel dieses Verfahrens ist es, eine vorzeitige Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses (insbesondere durch Kündigung) aufgrund dieser
Mehr erfahren